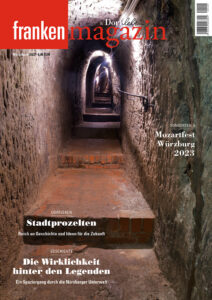Kulinarische Grüße aus der Jungsteinzeit
Zugegeben kein moderner Mensch möchte zurück zu den wenig komfortablen Lebensumständen des jungsteinzeitlichen Homo sapiens. Der Fund der Mumie vom Similaun, besser bekannt als Ötzi, gibt uns Auskunft darüber, wie hart die Zeiten dereinst waren. Aber manches aus jenen fernen Tagen feiert ein kleines geschätztes Comeback.
Text: Gunda Krüdener-Ackermann | Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Etwa der Waldstaudenroggen, eine Getreideart, die man bereits vor 7 000 Jahren im Vorderen Orient kultiviert und vorzugsweise auf Rodungsflächen ausgebracht hat. Extrem anspruchslos, denn er kann in Höhen bis zweitausend Meter und bei Temperaturen bis minus 25 Grad gedeihen, ist er auch bekannt als Sibirienroggen.
Die Wiederentdeckung solch alter, robuster Getreidesorten verdankt sich ein ganzes Stück weit der zunehmenden Skepsis etwa gegenüber dem handelsüblichen Turbo-Weizen, der das Mehl vor allem für konventionelle Backwaren liefert. Experimentierfreudige und handwerklich geschickte Bäcker, die Geschmack und Bekömmlichkeit ihrer Produkte forcieren wollen, sind jedoch offen für Neues, in diesem Fall für Altes, genau genommen Uraltes. So ist letztendlich die Zusammenarbeit zwischen den Bärenbrot-Bäckern in Pommelsbrunn und Landwirt Andreas Schmidt entstanden. Seit wenigen Jahren baut Schmidt auf rund 4,5 Hektar in idyllischer fränkischer Landschaft im Süden der Hersbrucker Schweiz diese Roggenart für Daniel Bärs Heimatkornbrot an. Allerdings zeigt sich dabei eins ganz deutlich: ohne sichere Abnehmer läßt sich derart „exotisches“ Getreide kaum vermarkten. Obwohl der Waldstaudenroggen unschlagbar gute Eigenschaften mit sich bringt. Seine Ertragsmenge ist allerdings erstmal kein überzeugendes Argument. Denn die Ähren tragen nur rund 25% des konventionellen Roggens. Wollte man damit Einfluß auf die Welternährung nehmen, würde man mengenmäßig kläglich scheitern. Der geringe Ertrag hat auch unweigerlich Auswirkung auf den Preis. Solche Backwaren kann sich schlichtweg nicht jeder als tägliches Brot leisten.
Unschlagbare Vorteile
Aber ansonsten bringt dieses Urkorn unschlagbare Vorteile mit sich – für Bauer und Konsument. Bis zu zwei Meter ragen die Halme in die Höhe und brauchen daher nur wenig Dünger, am besten den üblichen Mist. Alles andere wäre kontraproduktiv. Denn zu schwere Ähren lassen die Halme schnell abknicken. Auch Fungizide, die den Pilzbefall von Getreide in den Griff kriegen sollen, sind durch dessen Bodenferne weitgehend unnötig. Aufgewirbelte Pilzsporen schaffen es kaum in derart luftige Höhen. Hohe Halme wiederum brauchen kräftiges und weit verzweigtes Wurzelwerk, was der Bodenqualität besonders für anschließenden Gemüseanbau zugute kommt. Schlagend sind in jedem Fall die Vorteile für den Verbraucher. Denn der Waldstaudenroggen ist ein wahres Wunderkorn. Mit 50 % mehr Ballast- und Mineralstoffen als üblicher Roggen, dazu hohen Werten an essentiellen Aminosäuren, Proteinen, Vitaminen vor allem der B-Gruppe, dazu Eiweiß und … die Liste der Inhaltsstoffe liest sich wie die eines Super- und Beauty-Food. Und obendrein ist das Ganze zu köstlichem Brot verbacken noch ausnehmend schmackhaft.
Für den Landwirt hat dieser Roggen einen weiteren Vorteil – seine doppelte Nutzbarkeit. Bereits Ende Juni – daher auch ein weiterer Name: Johannisroggen – wird er ausgesät. Im Herbst dann, die erste Mahd der grünen Sprößlinge, die bestes, vitaminreiches Viehfutter ergeben. Die Pflanzen überwintern dann und treiben im Frühjahr erneut aus. Durch jene erste Mahd wachsen sie bis zur Ernte mit besonders ertragreichen Ähren heran. Nicht zu vergessen ist auch – Andreas Schmidts Vater als Jäger hat darauf aufmerksam gemacht – daß Ricken, also Rehmütter, ihre Kitze in diesem hohen Getreide besonders gerne verstecken. Wie überhaupt auch das langstielige Stroh des Waldstaudenroggen bevorzugt als Streu in Viehställen verwendet wird.
Wetterkapriolen
Aber auch anderswo wird mit alten Getreidesorten experimentiert. Weniger aus kulinarisch-gesundheitlichen, sondern mehr aus bautechnischen Gründen. Ein Projekt der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf und des Fränkischen Freilandmuseums widmet sich dem Anbau des sog. Langstrohroggen. Auch hier sind die Halme extrem lang und sehr robust. Man braucht sie als originales Dachdeckmaterial für die zum Teil aus dem 11. Jahrhundert stammenden Häuser der Mittelalter-Baugruppe des Museums. Während Landwirt Andreas Schmidt jedoch seine alte Roggensorte mit modernen Landmaschinen aussät und erntet, verwendet man im musealen Gesamtkonzept historische Mähmaschinen und Mähbinder. Man versucht hier so authentisch wie möglich zu agieren, zu erkunden, wie bäuerliches Leben dereinst aussah und sich anfühlte.
Eines können jedoch Bauer Schmidt wie auch das wissenschaftliche Projekt nicht mehr aus früheren Zeiten zurückholen: das bisher meist stabile Erntewetter. Auf einen beständig trockenen August war lange Zeit Verlaß. Es ist nicht mehr zu leugnen: der Klimawandel beschert eine Menge Wetterkapriolen, die das bäuerliche Leben ganz schön durcheinanderbringen. Ehrlicherweise muß man jedoch auch die Frage stellen: Ob das mit dem Wetter im Mittelalter oder gar in der Jungsteinzeit immer so ausgeglichen und menschenfreundlich war? Eher wohl nicht.