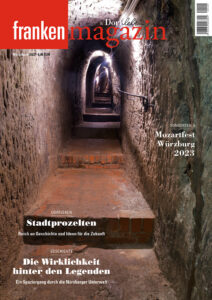Kahlschlag im Blätterwald
Über die Medienkrise und das publizistische Engagement der (fränkischen) Städte. Ein Essay. (Lesezeit ca. 30 Minuten)
Text + Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach
Prolog
In naher Zukunft werden wir (als Gesellschaft) entscheiden, anspruchsvollere Zeitschriften öffentlich-rechtlich zu unterstützen; für den Erhalt unseres demokratischen Gemeinwesens wird das unvermeidlich werden. Und es wäre zu empfehlen, dies möglichst bald zu tun, solange ernstzunehmende Expertise (engagierter klassischer Journalismus) und Infrastruktur noch vorhanden sind. Die öffentliche Hand als gewichtiger Akteur in der Presselandschaft, wendet ohnehin längst, wenn auch unspezifisch, um nicht: unkontrolliert zu sagen, Unsummen für die „Meinungsbildung“ (in ihrem Sinne?!) auf. Städte, Kommunen, Behörden, überhaupt die Exekutive bewegt sich damit nicht selten in eine vermutlich auch rechtliche Grauzone und schadet dem, was sie doch zu bewahren gehalten ist: Pressefreiheit und Meinungsvielfalt.
Städte und Kommunen rechtfertigen dies mit der Notwendigkeit, mit anderen Kommunen um Unternehmensansiedlungen und Einwohner wetteifern zu müssen; mit ihrer Pflicht, die Bürger über Serviceleistungen, neue Vorschriften und dergleichen zu informieren; und schließlich mit den Veränderungen der Presselandschaft. Die Lokalpresse (oft nur noch im Titel vorhanden) erfüllt aus vorgeblich wirtschaftlichen Gründen, ihren „klassischen“ Auftrag nämlich immer weniger, lokales Geschehen in Politik, Gesellschaft und Kultur gewissenhaft und umfänglich zu beobachten.
Publizistische Umweltverschmutzung
Die regionalen Presselandschaften werden natürlich noch immer von den Regionalzeitungen (es handelt es sich meist nur mehr um eine) maßgeblich bestimmt. Nach Einschätzung von Medienfachleuten dürften sie allerdings in den kommenden fünfzehn, zwanzig Jahren und vermutlich in hohem Maße aufgrund eigenem Verschuldens von der Bildfläche verschwinden. Konzentrationsprozesse, wie sie die „ökonomische Kolonialisierung des Journalismus“ mit sich bringen, sorgen längst dafür, daß z.B. in Augsburg gereimt wird, was in Würzburg und Bamberg gestottert wird oder umgekehrt.
Hinzu kommt in den größeren Städten eine Flut von Veranstaltungs- und Anzeigenblättern, Werbeprospekten, Flyern, Postwurfsendungen u.ä.. Die haben nichts bzw. nur sehr bedingt etwas mit Journalismus zu tun, übernehmen aber für viele Menschen entsprechende Funktionen. Genaugenommen sollte man von Umweltverschmutzung sprechen; wegen des Papierverbrauchs und vor allem geistig. Man darf jedoch hoffen, daß die Tage dieser Gazetten ebenfalls gezählt sind, da ihr ohnehin zweifelhafter Nutzen im Internet auf jeden Fall schneller, aktueller und unterhaltsamer erbracht werden kann.
Zunehmend wichtiger werden die wenigstens gegenwärtig nicht aus wirtschaftlichen Gründen gefährdeten Publikationen von Städten, Ämtern, öffentlichen Institutionen. Von Stadt zu Stadt unterscheidet sich freilich das publizistische Engagement erheblich. Es reicht von billig gemachten Blättchen über Beilagen in Tageszeitungen bis hin zu mitunter richtig edlen, am neuerlichen Trend des corporate publishings in der Werbebranche orientierten „Lean-Back-“ oder gar „Mind-Style-Magazinen“. Die gab es freilich schon früher, allerdings haben nur wenige überlebt wie etwa das seit 50 Jahren bestehende „Nürnberg heute“.
Bedrohte Arten
Einige anspruchsvolle, regionale Zeitschriften gibt es tatsächlich auch noch, jedenfalls bayernweit und abgesehen von reinen „Special-Interest-Zeitschriften“. Die „Lichtung“ aus Viechtach, die Zeitschrift „Muh“ aus Oberbayern, in Passau „Der Bürgerblick“, auch das Museumsmagazin „ZeitenRaum“ (wir wollen unsere eigenen Publikationen hier nicht unerwähnt lassen) und das Franken-Magazin, die – ohne all deren wirtschaftliche Situation im Einzelnen zu kennen – angesichts des gegenwärtigen Konkurrenzkampfes um Anzeigen und Auflage – wohl zumindest als „bedroht“ angesehen werden müssen.
Wer nun meint, es sollte in der von Zeit zu Zeit auflodernden Mediendebatte auch um das Überleben der bedrohten Presseerzeugnisse in der Provinz gehen, irrt. Vor allem kümmern sich die Propagandisten des digitalen Journalismus (wenn es ihnen schon um Journalismus geht) um einen offensichtlich monolithischen Block aus FAZ, SZ, Spiegel, Zeit, eben die „wichtigen“, großen Zeitungen und Zeitschriften, dem „Journalismus“ gewissermaßen an sich.

Zudem sind die Suffragetten der digitalen Revolution davon beseelt, mit der nur von ihnen in den Redaktionen inaugurierten Vielfalt auch gleich den Journalismus überhaupt zu retten.
Gelegentlich melden sich weniger euphorisierte Stimmen zu Wort. Cordt Schnibben etwa hatte 2013 die bis heute mal mehr, mal weniger befeuerte Mediendebatte im Spiegel sogar wieder mitangetreten (sagt man heute so!). Er räumt dem Print als eine Art Heimathafen noch eine gewisse Existenzberechtigung ein, wobei nicht recht klar wird, warum eigentlich. Für die gedruckte Zeitung – so scheint es – wird hingegen nur mehr in privaten Runden älterer Herren und Damen Partei ergriffen. Unter letzteren mag sogar der Niedergang der Presse in der Provinz, in der Region, in den Städten vielleicht noch Ärgernis sein. In der überregionalen Debatte zur Medienkrise kommt diese praktisch nicht vor. Warum auch? Die wenigen Verlage, die unter sich die Regionalzeitungen aufteilen, reichen eben lediglich ihr Elend nach unten durch.
Zur Medienkrise überhaupt
Einige Kulturtechniken haben sich über die Jahrtausende bewährt, ohne ernsthaft verwerflich zu werden. Schlafen! Frauen nie ausreden lassen! (Kleiner Scherz!) Lesen könnte dazugehören. Traumhafte Geschäftsfelder für eine disruptive Ökonomie. Nur während die Benachteiligung von Frauen zwar immer noch funktioniert, aber zunehmend unrentabler wird, kommt man mit der Verwertung des Schlafes – abgesehen davon, daß es mancherorts nachts schon heller ist als am Tag – noch nicht recht voran. (siehe: Jonathan Crary. Schlaflos im Spätkapitalismus. Berlin 2014)
In puncto Desinformationsökonomie (ein giftigeres Derivat der disruptiven), in puncto Kommunikation, Lesen, Journalismus sind die Neuerer hingegen erfolgreich. Dank ökonomischen Verlockungen und der Faszination von Gadgets gelingt es inzwischen in der öffentlichen Debatte, die Frage nach Sinn und Zweck digitaler Kommunikation, wenn schon nicht gänzlich zu verhindern, so doch wenigstens in gesellschaftlich irrelevante Nischen (Volkshochschulen, SPD-Wahlkampfveranstaltungen) abzudrängen. Digitalisierung ist ohnehin nahezu ausnahmslos ein Wirtschaftsthema. Verzögerungen und Versäumnisse bei der digitalen Modernisierung vor allem eben im Bereich der Kommunikation versündigten sich am Wirtschaftsstandort, so der einhellige Tenor. Massiver Arbeitsplatzabbau, der Ruin ganzer Branchen, die Ängste vieler Menschen werden zwar mitunter wahrgenommen, aber mit dem Versprechen weiterer Wettbewerbsfähigkeit und damit künftigen Wohlstands, billigend in Kauf genommen, parteiübergreifend.
Kulturpessimistischen Tiraden
Selbst neurophysiologische, psychologische, mentale, soziale Folgen oder Schäden, die vor allem jugendlichen Nutzern etwa von Smartphones (weltweit sind es gegenwärtig rund drei Milliarden User) drohen könnten, von harmlosen Selbstmorden, über lästige Depressionen bis zu ärgerlichen Verkehrsbehinderungen, beunruhigen Bildungspolitiker, Pädagogen und selbst Journalisten kaum noch („Solche kulturpessimistischen Tiraden sollten bestenfalls mit einem gütigen Lächeln abgewehrt werden.“ Sebastian Herrmann / SZ am 2./3. Oktober 2017 Seite 1). Man setzt auf die Erziehung zur „Medienkompetenz“. Und man meint dann allen Ernstes, bei süchtigen Smartphonikern gegen die „Flammen“ von Snapchat, gegen die Likes und wie die virtuellen Gratifikationen sonst noch heißen, anzukommen. Gut, vielleicht, in einzelnen Fällen!
In einen ähnlichen Engpaß führt die Diskussion um die Zukunft des Journalismus. Wo Ertragseinbrüche und Fake News in der „Medienkrise“ konvergieren, wird das Problem schnell auf die sportliche Frage verkürzt, ob Printmedien in der digitalen Welt werden bestehen können. Als ginge es nur darum, ein bräsiges Lean-Back-Medium, dessen Follower die Inhalte erriechen und ertasten, gegen einen, an den echten Informationsbedürfnissen des Nutzers ausgerichteten, augmentierten Journalismus zu stellen. Oberflächlich betrachtet könnte es doch einerlei sein, in welchem Aggregatzustand der Journalismus überlebt – flüchtig oder in Stein gemeißelt.
Doch: „Print stirbt langsam, aber es stirbt.“ So unlängst die zehn Monate in Stanford/USA als Fellow im Knight Journalism Program der Universität verjugendlichte Ressortleiterin Innovation und Digitales der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“, Astrid Maier. Ob wir das jedoch auch wollen sollten, steht für sie schon gar nicht mehr zur Debatte. Dabei: Haben nicht die Verlage, gewissermaßen mit dem Harvester, mittels Konzentrationsprozessen, Boulevardisierung, News Desks, Personalabbau, dem Aushöhlen und Unterlaufen von Tarifverträgen, Kettenbefristungen, Leserreporter, Kooperationsverträge, überhaupt mit ihrer Ökonomisierung und Kommerzialisierung der Medien besonders seit den 1980er Jahren – man tut sich schwer, die verlagspolitischen Innovationen haarklein aufzulisten – … haben also nicht die Verlage, zumindest die großen bis in die Provinz hinein, über Jahrzehnte eine Presselandschaft und damit Sachzwänge geschaffen, die nun nur mehr einen „lesergesteuerten“ digitalen Journalismus als Ausweg zulassen, vor allem wenn damit zuvorderst Geld verdient werden soll?
Was ist digitaler Journalismus?

Was übrigens keineswegs in Abrede stellt, daß sich wechselseitig bedingende, mediengeschichtliche und technische Entwicklungen bestimmenden Einfluß auf Verlagsentscheidungen haben und in der Vergangenheit immer hatten. Fraglich ist lediglich, ob alles, was beispielsweise technisch möglich ist und sich wie ein unabänderliches Naturphänomen aufführt, auch unbedingt angewendet werden muß. Und sei es nur, um wenigstens zu beobachten, ob sich eine Technologie überhaupt längerfristig bewährt, bewähren kann. Es gibt reichlich Beispiele, wo Verlagshäuser oder Presseagenturen für großes Geld eine neue Redaktionstechnik (Hard- und/oder Software etwa von einer Fa. Crossfield) einführten und nach wenigen Monaten alles wieder verschrotteten, weil die Lieferfirma in Konkurs ging, das System mit anderen, die inzwischen die Standards vorgaben, nicht kompatibel war oder ähnlichem. Ganz abgesehen von der schon angeführten Frage, ob wir Karthago wirklich zerstören sollten.
Gleich gar, wenn zwar ansatzweise (oberflächlich) abzusehen ist, was dieser digitale Journalismus eigentlich ist, keinesfalls aber, was er mit uns allen macht. Tatsächlich scheint es sogar schwieriger, sich darauf zu verständigen, was Journalismus überhaupt ist. Die Erklärungen reichen vom charmanten „Selbstgespräch, welches die Zeit über sich selbst führt“ eines Robert Eduard Prutz (1816-1872), der vor rund 150 Jahren eine „Geschichte des deutschen Journalismus“ (siehe: Löffelholz. Wiesbaden 2004) schrieb, bis zur operationalen Definition in Wikipedia, wonach Journalismus das ist, was Journalisten machen. Ohne es als Definition verstehen zu wollen, soll Journalismus hier als Praxis der professionellen Mitglieder eines gesellschaftlichen Subsystems verstanden werden, die im Auftrag und im Sinne einer Allgemeinheit andere gesellschaftliche Subsysteme, wenn nicht die Gesellschaft in Gänze, beobachten und bewerten und ihre Ergebnisse in durchaus verschiedenen Formen einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und offensichtlich wirkt sich Journalismus, indem er gesellschaftliche Komplexität reduziert wie auch herstellt auf das Zusammenleben der Mitglieder einer Gemeinschaft bzw. Gesellschaft aus. In den meisten Journalismustheorien geht es denn auch darum, daß der Journalismus zu einem Gelingen des Zusammenlebens betragen und insofern auf Aufklärung, Vermittlung, Verstehen, Rationalität ausgerichtet sein sollte.
Digitaler Journalismus, wenn nicht bloß e-paper gemeint sind, nimmt ja für sich selbst in Anspruch von anderer, neuer Qualität zu sein. Digitalen Journalismus geht es um Involvement, um Immersion (bis zur Präsenz), um Erleben, um das Aufheben der Distanz zur Realität, aber nicht um Verstehen.
Astrid Maier lehrt uns diesbezüglich das Fürchten: „Tablets haben als Plattform Printmagazine nicht abgelöst? Kein Grund, sich auszuruhen. Das Smartphone holt gerade alles auf und ist dabei, gedruckte Medien in allem zu überholen, was sie bis vor kurzem noch besser konnten. Newsletter, digitales Storytelling, Augmented Reality – die neuesten Digitaldienste werden immer besser, interaktiver. Sie ziehen die Nutzer regelrecht in die Geschichten hinein. Denn digitale Storys auf dem Smartphone werden mit besseren Bildern und einprägsameren Grafiken in perfekter Auflösung angereichert, das Storytelling ist intuitiver aufgebaut. Früher schmissen die Verlage ihren Lesern die Zeitung auf die Haustreppe vor die Tür. Heute können auch Start-ups ihren Abonnenten auf dem Smartphone mit den besten Geschichten direkt auf den Leib und in die Hosentasche rücken.“ Es geht Astrid Maier – geradezu zynisch – nicht um Inhalte. Es geht um leere Vielfalt und es geht um Design: „Dabei ist die digitale Revolution die größte Designbewegung der vergangenen Dekaden. Daß gerade Design die Kunden anzieht und an ihre Angebote bindet, wenn nicht süchtig danach macht, haben als Erste Techangreifer wie der Bettenvermittler Airbnb entdeckt. Auch Facebook, Twitter und Co. gestalten ihre Dienste so, daß sie einen nicht mehr loslassen, wir nach der nächsten Meldung, Benachrichtigung oder dem nächsten Pieps lechzen.“ […] „Die Zukunft der Medien ist vor allem schön anzusehen.“
Leser und Nutzer
Schön in diesem Sinne ist jetzt schon ein Text der kongenialen Barbara Hans, der Mitte August in zwei Varianten (Copy and Paste) Spiegel-Online intellektuell bereicherte. Der Text basierte auf ihrer Eröffnungsrede zur Dverse Media Konferenz im Dezember 2016 in Hamburg – an der allem Anschein nach auch Astrid Maier teilnahm – und diente schließlich wohl auch als „Keynote zum Start des Master-Studiengangs >Digitale Kommunikation< an der HAW Hamburg. Natürlich geht es auch Barbara Hans um Vielfalt, die verhindern soll, daß der deutsche Journalismus seine Glaubwürdigkeit gänzlich verspielt. Natürlich hat sie klare Vorstellungen von den Vorzügen des digitalen im Gegensatz zum analogen Journalismus: „Der digitale Journalismus ist fokussiert auf den Nutzer. […] Denn die Nutzer, ihr Nutzungsverhalten sind für uns allgegenwärtig. Wir sehen, wie sich die Nutzer durch ein Angebot navigieren. Wir bekommen die Daten in Echtzeit. Wir sind permanent damit konfrontiert, was für den Nutzer relevant ist: zu einer bestimmten Tageszeit, in einer bestimmten Situation. Der Begriff der Relevanz wird damit demokratisiert: Wichtig ist nicht länger nur, was der Journalist als wichtig erachtet. Vielmehr bietet sich dem digitalen Journalismus die permanente Möglichkeit des Abgleichs. Wie funktioniert mein Text? Wie viele Leser findet er? An welchen Stellen eines Artikels steigen die Leser aus? Was sagt uns das über den Aufbau von Texten?“ Um Click-Baiting geht es ihr selbstverständlich nie. Es machte den Journalismus beliebig, „wenn einzig der Klick zählt, nicht aber der Nutzer dahinter“.

Dem digitalen Journalismus geht es aber auf jeden Fall nicht mehr um den Leser, sondern um den Nutzer; und es handelt sich dabei keineswegs um ein optimiertes Erkenntnissubjekt. Der Nutzer ist in der digitalen Welt nur von Bedeutung, wenn er das Gerät, das ihm Zugang verschafft, auch wirklich nutzt. Und zwar auch nur in dem Moment, in dem er es nutzt. Anschalten und auf die Kommode legen gilt nicht. Während der Leser, nicht zwangsläufig, aber u.U. sich Wissen aneignet, das er u.U. nicht einmal unbedingt gebrauchen kann, (was für Autor und Verlag in der Regel weder zusätzlichen Gewinn noch Verlust erbringt und insofern völlig unerheblich ist) muß der Nutzer, um Nutzer überhaupt zu sein, fortwährend irgendwelche Operationen ausführen. Die sind zwar auch nicht unbedingt für den Nutzer von Nutzen. Sie nutzen aber – auf jeden Fall finanziell – all jenen, die die Inhalte zur Verfügung stellen (die Dritten als Plattform, als Pinwand für Werbung dienen). Und zwar je mehr, desto mehr der Nutzer sie nutzt und je mehr Nutzer sie nutzen. Weshalb das Ermöglichen und mehr noch das Herstellen von Interaktion – unabhängig eines möglicherweise geistigen Wertes – letztlich nichts weiter als eine Marketingstrategie ist.
Journalistische Qualität
Im Endeffekt geht es jedem digitalen Journalismus offensichtlich doch um das Click-Baiting. Wie dieses „Involvement“ erreicht wird hat Astrid Maier oben ja sehr schön beschrieben. Der Nutzer wird durch ein „intuitiveres Storytelling“, einen möglichst gut gestalteten Mix aus Text, Bild, Film, Musik in eine Story hineingezogen. Es werden möglicherweise alle Regeln zur Verfertigung eines guten journalistischen Textes – so wie sie seit jeher bei der Ausbildung zum Journalisten gelehrt werden -, eines eindrucksvollen Fotos, eines spannenden Films oder schließlich eines emotional ansprechenden Musikstückes beachtet. Das auf einer Plattform dann ineinander verschränkte Angebot informiert zwar möglicherweise, stellt zugleich aber vor allem Irrationalität her. Während ein einzelner Text in einem Printmedium, insofern eben kein unmittelbarer Kontakt zwischen Sender und Empfänger besteht, ein Überlegen, Nachdenken bis hin zu einer im Großen und Ganzen möglichen Textanalyse erlaubt, bereiten Bild- und Filmanalysen größere Schwierigkeiten. Es läßt sich nicht so ohne weiteres – wenn überhaupt – rational klären, ob in den Talkshows der deutschen TV-Sender trotz kritischer Moderatoren die AfD gemästet wurde. Wesentlich leichter wäre, den Anteil der großen Tageszeitungen daran herauszufinden. Die schiere Menge an zu prüfenden Artikeln mag ein Problem sein. Aber, wie gesagt, einzelne Texte können auf ihre Aussage hin befragt werden; Bild, Film …?

Das digitale Medium, um es vorsichtig auszudrücken, fördert kein Überlegen und erlaubt es strenggenommen auch nicht. Jede Unterbrechung, jede Pause und man läuft Gefahr neuesten In-put, neueste Entwicklungen nicht mitzubekommen. Die Aktualität, in der Tat ein Kriterium für journalistische Qualität, wird zur Echtzeit pervertiert zum, wenn nicht alleinigen, so doch zum wichtigsten Qualitätskriterium stilisiert. Der „permanente Abgleich“ mit dem Nutzer hat jedoch lediglich formal Wert. Nicht umsonst weisen Astrid Maier wie Barbara Hans („Es ist nicht die Aufgabe des Journalismus, zu missionieren.“) für ihren digitalen Journalismus jeglichen Bildungsauftrag wie jegliche Wächterfunktion, wie sie von Bundesverfassungsgericht am 25. April 1972 dem Journalismus aufgetragen wurden, entschieden zurück. (Übrigens auch Frank Plasberg: „Es ist nicht meine Aufgabe, die Demokratie zu heilen.“ / Überschrift in derBildzeitung ??? )
Und doch soll der digitale Journalismus wenigstens über die Schwundstufe eines „emanzipatorisches Potentials“ verfügen, wenn Barbara Hans in der formal eingerichteten „Demokratisierung der Relevanz“ die Möglichkeit sieht, im analogen Journalismus verspielte Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Nur hat sich jedes emanzipatorische Potential der „neuen Medien“ stets als trügerisch erwiesen.
Die Mär vom emanzipatorischen Potential
1994 hatten Al Gore, damals Vizepräsident der USA, und kurz darauf Martin Bangemann als EU-Kommissar für Telekommunikation mit der globalen Informationsgesellschaft wunderbare sozialpolitische und ökonomische Erwartungen verknüpft. Der „Informations Superhighway“ sollte ebenso unterhalten wie informieren, sollte bilden, die Demokratie fördern und Leben retten. (Versprechen, die übrigens auch heute noch aus dem Silicon Valley tönen.) Nur konnte man wenig später schon feststellen, etwa Hans Magnus Enzensberger, der 1988 bereits einmal das Fernsehen als „Nullmedium“ bezeichnet hatte, daß die Neuen Medien zwar emanzipatorisches Potential haben, die jedoch keine Rolle spielt. Die sozial- und kulturpolitischen Ziele, die Gore und Bangemann mit der Informationsgesellschaft verwirklichen wollten, zerschellen zumeist an wirtschaftlichen „Notwendigkeiten“ und ironischerweise auch am bevorzugten Gebrauch, den die Menschen von den Medien machen. „Während sich aber als eigentliches Problem der Kontrollierbarkeit die schiere Masse an Inhalten erweist, offenbart deren >überwältigende Banalität<, wie trügerisch die Prophezeiung von der emanzipatorischen Kraft der neuen Medien tatsächlich ist. In dieser Banalität findet Interaktivität ihre Grenze …“ […] „Zwar beweist das Netz tagtäglich seine Offenheit und Freiheit auch als >Dorado für Kriminelle, Intriganten, Hochstapler, Terroristen, Triebtäter, Neonazis und Verrückte<, aber diese Offenheit leistet bedauerlicherweise nicht viel mehr als >schlicht und einfach die Geistesverfassung seiner Teilnehmer< (Enzensberger) abzubilden.“ (in: Theorien der Neuen Medien. G.Rusch, H. Schanze, G.Schwering. Paderborn 2007)

Barbara Hans ist sich nun durchaus bewußt, daß „das, was vom Nutzer an uns zurückgespielt wird“, nicht immer angenehm und „weiß Gott nicht immer nett“ ist. Sie setzt vermutlich auf das bald in allen großen Redaktionen eingeführte, algorithmus-gesteuerte „Audience Management“, das Banalitäten und Hate-speech aussortiert, bevor sie sie zu Gesicht bekommt, …! … und auf die Tugenden des klassischen, analogen Journalismus. Sie suggeriert einen Qualitätsanspruch, der sich an Kriterien wie eben Aktualität, Relevanz, Richtigkeit bzw. Wahrhaftigkeit und Vermittlung orientiert und doch selbst in wissenschaftlicher Überprüfung nicht recht dingfest zu machen ist. (vergl. Martin Löffelholz. Theorien des Journalismus. Wiesbaden 2004)
Schlüsselbegriff „Vertrauen“
Der digitale Journalismus soll zudem „vom Nutzer über den Nutzer lernen“ Texte besser zu machen, „weil man viel kritischer auf sie schaut, wenn man weiß, wie weit die Nutzer lesen“ (140 Zeichen?). Und er muß das klassische Handwerkszeug noch sorgfältiger nutzen. Recherche und guten Textaufbau – als wären Generationen von Journalisten vor ihr alles Idioten. Schließlich aber ist für die Spiegel-online-Autorin „Vertrauen“ geradezu der Schlüsselbegriff. „Wie kann es uns gelingen, Vertrauen zurückzugewinnen, …“ Liest man allein den „szenischen Einstieg“, den Barbara Hans für ihren Text „gewählt“ hat, die Wiedergabe einer E-Mail an Spiegel-online vom ersten Weihnachtstag, kurz nach 22 Uhr, möchte man sofort antworten: So jedenfalls nicht! Die Frage des „Nutzers“ Fabian Schulz an die Redaktion, wie er seinen Vater vom Glauben an die aberwitzigsten (und zwar fast alle) Verschwörungstheorien heilen könnte, ist so durch und durch konstruiert, daß es richtig schwerfällt, auch nur eine Zeile weiterzulesen. Aber es illustriert das rein operationale Verständnis der Autorin von Vertrauen. Vertrauen ist für sie eine Strategie. Sie ist offensichtlich davon überzeugt, daß man Vertrauen „herstellen“ könne.
Möglicherweise hat man sich Vertrauen verdient, nach landläufiger Auffassung aber wird Vertrauen „geschenkt“ und kann gerade nicht bewußt erarbeitet werden. („Ich war jetzt drei Wochen treu, jetzt kannst Du mir doch wieder vertrauen.“) Was übrigens sogar davon bestätigt wird, daß Menschen oft anderen vertrauen, die es nicht verdienen.
Richtig interessant ist jedoch, daß Barbara Hans auch das Vertrauen des Journalisten in seine (nun spricht sie nicht vom Nutzer) Leser anspricht, ohne dies allerdings weiter auszuführen. Für die Wiederherstellung von journalistischer Glaubwürdigkeit ist dies tatsächlich der bedeutsamste Aspekt. Damit liegt es nämlich allein beim Journalisten, ob er darauf vertraut, daß der Leser (!) etwas erfahren will – und in diesem Umfang auch: lernen; ob der Journalist eben gerade nicht für eine Zielgruppe schreibt, nicht gemäß bestimmter Analytics mit seinem Wissen hinter dem Berg hält. Im Idealfall muß er darauf vertrauen, daß der Leser ebenso so schlau, so gescheit ist wie er, er hat dem Leser lediglich voraus, was er gewissenhaft und sorgfältig recherchiert hat und nun mitteilt, weil es der Leser vermutlich noch nicht wissen kann bzw. sich nicht so klargemacht hat. Sobald der Journalist seine Story „vereinfacht“ („Schreiben Sie so, daß auch der Dümmste Ihrer Leser es noch versteht.“ Redaktionelle Dienstanweisung in einer fränkischen Tageszeitung schon vor 30 Jahren.), von der Sache wie von der Sprache so zubereitet, wie er es selbst nie lesen wollte, verdient er das Vertrauen des Lesers nicht. Es mag sein, daß so die Anzahl der Leser u.U. begrenzt wird, arrogant ist dies jedoch nur, wenn der Journalist sich wider allen Anstands über denjenigen, der ihn nicht versteht, erhebt. Arrogant ist hingegen ein Satz von Barbara Hans wie: „Ein Kollege der >Washington Post< erzählte mir kürzlich vom Leitsatz seiner Redaktion: >Don’t be boring<.“ Arrogant und so platt, daß einem die Studenten, die sie unterrichtet, nur leidtun können.
Künstliche Intelligenz in der Redaktion
Allerdings kommt hier die „Washington Post“, in der Szene gern „WaPo“, gerade recht: Seit Watergate ein journalistischer Leuchtturm und seit Trump auch wieder wirtschaftlich erfolgreich; Printmedium und – wohl nicht zuletzt dank ihres Besitzers, Amazon-Chef Jeff Bezos – Vorreiter beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Zeitungsredaktion.
Bei der WaPo weist das Programm „Clavis“ Mitarbeitern bestimmte Themenbereiche zu und erteilt Aufträge; das Data-Mining-Programm „Bandito“ erstellt selbsttätig aus verschiedenen Quellen (Content) Variationen samt der errechneten Wahrscheinlichkeit für virale Verbreitung; „>Headliner< analysiert Texte und schlägt passende Überschriften vor, die erwiesenermaßen bei Lesern gut funktionieren.“ (siehe: medium – magazin für journalisten 4/2017 S. 64 ff) Schließlich könnten Faktencheck-Units bald dafür sorgen, daß nichts in der Zeitung steht, das nur wünschenswert ist.
Bei der NewYork Times etwa gibt es die Software „Moderator“, die Leserzuschriften ordnet und beantwortet – im Prinzip das Gegenstück der oft gescholtenen Social Bots – , allein vom Algorithmus als besonders brillant bewertete Zuschriften wandern noch auf den Tisch eines leibhaftigen Redakteurs. Inzwischen kann intelligente Software bereits Shakespeare simulieren. Die Prophezeiung, ein Roboter-Journalist würde im Jahr 2016 den Pulitzer-Preis erringen, hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Noch! (ebd.) Und doch müßte man sich kaum wundern, wenn demnächst der immersive Journalismus seinen Siegeszug antritt, der Nutzer die Virtual-Reality-Brille aufsetzt und sich mitten in der Schlacht um Rakka befindet. Das ist kaum anders als Egoshooter, nur noch echter wirklich.
Gerade journalistische Leuchttürme wie die WaPo könnten bald zu Lehrbeispielen werden, wie Journalismus selbst im Print jegliches Bemühen um Glaubwürdigkeit formalisiert und damit strenggenommen aufgibt; und andererseits auf digitalen Plattformen durch eine Bastardisierung von Genres wie Literatur, Fotografie, Musik und Film (Buzz feed) oder eben einem immersiven Journalismus (VR), schließlich zu einem reinen Unterhaltungsprogramm wird. Damit hätten sich freilich Probleme, wie Fake News oder was der manchmal richtig gute Spiegel-Kolumnist Sascha Lobo als Mediennihilismus bezeichnet, von selbst erledigt. Gottlob hat Lobo eine bessere Idee. Er empfiehlt gegen die „Erosion des Vertrauens“, unter der im 20. Jahrhundert fast alle Institutionen leiden, am stärksten aber „die Medien, die vierte Gewalt der Demokratie“, eine „offensive Transparenz“. Wenn Leser hinter journalistischer Arbeit unlautere Motive vermuten, helfe seitens der redaktionellen Medien nur „Selbsterklärung“ und „Selbstverortung“. Das könnte richtig heiter werden, wenn künftig jede Edelfeder ihren Paratext zu einer Homestory aufbläht. Was Lobo allerdings übersieht: Ein solche Strategie läuft Gefahr, sich selbst zu dekonstruieren, weil es nur allzu leicht zu einem Widerspruch zwischen den konstatierenden (oder demonstrativen) und den performativen Komponenten kommt. Wer sagt mir als Leser denn, daß die Selbsterklärungen nicht nur besonders geschickt gelogen sind? Sind Selbsterklärungen nicht erst recht verdächtig?
Da die wenigsten Leser bis hierher kommen, erfahren sie natürlich auch nicht, was es nun mit der lokalen Presselandschaft auf sich hat.
Es mag vielleicht nicht allerorts gleich sein, aber zu den bestimmenden Größen der lokalen Presselandschaften gehört die Flut an kostenlosen Anzeigen- und Veranstaltungszeitschriften. Die Titel sind vielversprechend, wie sollten die Inhalte da enttäuschen? Unübertroffen: „Lust auf Gut“ (Würzburg), ein bebilderter Schadensbericht über den Geisteszustand von Premiumkunden; hingegen Stadt- und Veranstaltungsmagazine wie: „Hugo“(Erlangen), „Fritz“(Unterfranken), „Mohr“(Coburg), „Topmagazin“(überregional), „Marlen“(Nürnberg), „Der Kessener“(Würzburg), „pablo“(Aschaffenburg), „Curt“(Erlangen)), „Lohnenswert“(Unterfranken) oder „Doppelpunkt“(Nürnberg, Fürth, Erlangen) – um einige zu nennen – klingen wenigstens nicht gleich so, als müßte man sich Sorgen machen. Frankens Verlegern sind sie Ärgernis wie zynischer Beleg für eine vielfältige Presselandschaft, die jedoch – das räumt man ein – nicht ausreichend die „verschiedenen Lebensrealitäten der Leserinnen und Leser widerspiegelt“. Freilich macht schon die gegenwärtige mediale Hyperdiversität es unmöglich, sich auch nur einen vagen Überblick zu Anzahl, Auflage, Erscheinungshäufigkeit oder gar Wirtschaftskraft solcher Druckerzeugnisse zu verschaffen, geschweige denn ihre Wirkung auf die mündigen Bürger zu beurteilen. Wie schon gesagt: Mit Journalismus – nicht einmal „konstruktiven“ – haben diese Intelligenzblätter nichts zu tun. Ein Großteil der Bevölkerung bemerkt das allerdings gar nicht. Sei es, weil sie (inzwischen gibt es 14 Prozent funktionale Analphabeten in Deutschland) gar keine zusammenhängenden Sätze mehr lesen können; sei es, weil überkomplexe Sachkenntnis schlicht das Urteil trübt. Die Krise der Medien ist vor allem auf dem Land, in der Region eben mehr und mehr eine Krise der „Leser“, denen in Jahrzehnten deutscher Medienvielfalt Ansprüche nach gutem Journalismus entweder nie vermittelt oder vor dem Fernseher abhandengekommen sind. Insofern ist es dumm oder zynisch, der Glaubwürdigkeitskrise der Presse, wie dies die oben bereits gewürdigte Barbara Hans vorschlägt, mit einer abermals gesteigerten Anpassung an die „vielfältigen Leserrealitäten“ begegnen zu wollen. Man beschleunigt lediglich den Prozeß der Desorientierung beim Leser, wie er vor längerer Zeit mit der programmatischen Vermischung von Information und Unterhaltung ersonnen wurde. Inzwischen machen eine offensichtlich nicht aufzuhaltende Divergenz einerseits und die gleichzeitige Konvergenz der Medien andererseits das Chaos perfekt. „Es entsteht eine außerordentliche Fragmentierung bei der Übermittlung und Rezeption von Nachrichten und Ansichten, und gleichzeitig konvergieren alle traditionell getrennten Medien wie Zeitung, Fernsehen und Radio auf denselben Plattformen, wo sie sich mit Video-Live-Streaming, Podcasts, Sozialen Medien, Tweets und anderen nutzergenerierten Inhalten (wie etwa Filmmaterial über dramatische Ereignisse, das von Passanten mit dem Handy aufgenommen wurde) sowohl vermischen als auch einen Konkurrenzkampf liefern.“ (Timothy Garton Ash, Redefreiheit. Bonn 2016)
PR-lastig
Wenn scheinbar unbeeindruckt von solchen Entwicklungen von verschiedenen Autoren – jüngst z.B. dem Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch / FR vom 18.8.2017) – geradezu emphatisch betont wird, es bestehe nach wie vor großes Interesse an seriösen, guten Journalismus, dann haben sie sicher nicht die Verhältnisse in Orten vor Augen, wo es die FAZ, die SZ nur im Bahnhofskiosk und noch einer Handvoll Geschäften gibt. Immerhin könnte es auch sein, daß die Regionalzeitungen einfach an den Bedürfnissen (und Lebensrealitäten) ihrer Leserschaft vorbeigeschrieben haben. Nun will man den Informationsbedürfnissen der Leser besser entsprechen, indem man lokale Kulturberichterstattung stark einschränkt, Public relations und Öffentlichkeitsarbeit immer größeren Einfluß auf die Berichterstattung einräumt – ganz im Sinne eines „positiven“ Journalismus“ – oder schließlich den Berufsalltag der beständig weniger werdenden Journalisten zunehmend verdichtet. Inzwischen muß jede journalistische Arbeit einschließlich Fotos und Filmsequenzen für den Print in verschiedenen Fassungen wie für online (von Facebook und Instagram bis Twitter) aufbereitet, also auf das wirklich Wichtige konzentriert werden. Freilich, der Schwund von Lesern wie der Rückgang von Anzeigenaufkommen in den Verlagsprodukten, die nicht einfach nur kostenlos verteilt werden, geht dem Vernehmen nach beharrlich weiter. Und es sind verständlicherweise die Regional- und Lokalzeitungen, die zuerst in eine prekäre Lage geraten sind und die Presselandschaft gewissermaßen von innen austrocknen. Was übrigens nicht ausschließt, daß es noch schlimmer kommen könnte. Neben den allein schon die Pressevielfalt bezeugenden Anzeigenblättern gibt es selbst in den größeren fränkischen Städten praktisch nur mehr eine bzw. anderthalb Tageszeitungen. (Vor 105 Jahren gab es in Nürnberg neun Tageszeitungen, woraus man allerdings keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte.) … anderthalb Tageszeitungen, deren sorgfältig recherchierte Inhalte werden einerseits vermehrt (natürlich nicht ausschließlich) von Agenturen geliefert (Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Vermischtes). Andererseits (und ebenfalls zunehmend) versorgen Ämter, Behörden, Verbände, Unternehmen, Kirchen, Vereine und Veranstalter die Tageszeitungen mit „sachlich fundierten“ Pressemitteilungen. Inzwischen treten Redakteure von Tageszeitungen und selbst von Presseagenturen an Pressestellen der Städte heran und verlangen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Text und Bild, was sie dann praktisch unverändert „ins Blatt“ übernehmen. Die PR-Lastigkeit gilt sogar für den neuerlichen Trend, in den Wochenendausgaben „magazin-iger“ aufzutreten. Könnte man doch meinen, die Redaktionen hätten für Feature und bunte Geschichten mehr Zeit. Oft tropft gerade aus solchen Geschichten jedoch die PR wie das Blut aus der Bild-Zeitung.
Mißachtung von Presse- und Wettbewerbsrecht
Natürlich gibt es in örtlichen Redaktionen noch immer Kolleginnen und Kollegen, die ihr Handwerk verstehen und (gelegentlich – nur viel zu selten) gute, für das Geschehen in den Kommunen – damit für unsere Demokratie überhaupt – wertvolle Beiträge verfassen und somit „teilen“ können. Rein formal erfüllen übrigens die besagten Pressemitteilungen durchaus ebenfalls professionelle Anforderungen, haben doch die Autoren ihre Ausbildung und Berufserfahrung – bis zu ihrer Freistellung – in den Verlagshäusern erworben, die jetzt deren Arbeit auch mit Fug und Recht kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen.
Nur wenige städtische Pressereferenten sprechen es offen aus: die Zeitungen erfüllen ihre gesellschaftlichen Aufgaben, wofür ihnen sogar bzw. ihren Mitarbeitern einige Vergünstigungen gewährt werden, vom banalen freien Eintritt bis zur, wenn auch seltener werdenden Bewirtschaftung oder dem Tendenzschutz bei der Nichtvorlage von Geschäftsergebnissen immer weniger. Wohl auch deshalb sind die Kommunen in den vergangenen zwanzig, dreißig Jahren nahezu allerorts zu einem immer gewichtigeren Akteur in der Presselandschaft geworden. Sie sind Herausgeber von Publikationen, Stadtillustrierten, Magazinen, bei denen nun oft nicht mehr deutlich wird, ob es sich um den Kommunen natürlich zuzustehende Image-, Werbe-, städtische Service- bzw. Informationsbroschüren oder ob es sich bereits, womöglich gar unter mehr oder minder deutlicher Mißachtung von Presserecht, Wettbewerbsrecht und Kommunalrecht, um Pressepublikationen handelt. Schleichend vermischt sich immer häufiger das Bemühen der Kommunen, ihren Bürgern für das Gemeinwesen erforderliche Informationen zukommen zu lassen, mal mehr, mal weniger mit dem politischen Interesse, sich für die öffentliche Meinung ins rechte Licht zu setzen, etwa kommunalpolitische oder kulturpolitische, mitunter auch umstrittene Entscheidungen dem Bürger „verständlich“ zu machen. Und dies geht obendrein oft damit einher, daß seitens der Behörden, Auskünfte, schließlich könnte alles irgendwie für Kritik genutzt werden, nur widerwillig und wenn irgend möglich gar nicht erteilt werden. Inzwischen hat man den Eindruck, daß Stadtverwaltungen allein den Umstand, in ihrer Publikation etwas veröffentlicht zu haben, so verstehen, als hätten sie ein strittiges Thema mit den Bürgern ja ausreichend diskutiert.
Medienengagement von Stadt zu Stadt verschieden.

Doch jenseits davon: Gemeinsam ist den Städten, wie gesagt, das Bemühen, z.B. ihre Veranstaltungen anzukündigen und dabei zugleich Lebensqualität, ihre Attraktivität für Unternehmen, Bürger und Touristen herauszustellen. Und dafür werden alle Register gezogen. Waren es in den Anfängen des Medienengagements der jeweiligen Stadt oft noch sehr anspruchsvolle, inzwischen wahrscheinlich „Mindstyle-Magazine“ genannte Zeitschriften („Nürnberg heute“ oder auch das vor einigen Jahren eingestellte „Würzburg heute“), sind es mittlerweile neben einer Flut von Prospekten, Flyern und Programmheften (und natürlich Internetauftritten und Apps) natürlich noch Hochglanzpublikationen. Aber auch auf normalem Zeitungspapier gedruckte Beilagen in Tageszeitungen, bei denen die Städte deren Auflage und Distributionsmöglichkeiten nutzen. Solange übrigens die Städte diese Publikationen in Zusammenarbeit mit den Tageszeitungen bzw. lokal wichtigen Verlagen erstellen, drucken, verbreiten, akzeptieren diese auch, wenn sie als Mitbewerber auf dem Anzeigenmarkt privilegiert wildern.
Undurchsichtig, sagen wir: in den jeweiligen, jüngeren Stadtgeschichten vergraben, ist die unterschiedliche Bereitschaft von Stadtverwaltungen (einschließlich den Stadträten), für Öffentlichkeitsarbeit und eigene Publikationen Geld auszugeben. Das reicht von rund 200.000 € jährlich, die sich die Stadt Fürth ihre 14tägig erscheinende, 32 bis 36 Seiten starke „Stadtzeitung“, die an 69.000 Haushalte verteilt wird, kosten läßt, über jährlich rund 100.000 € in Schweinfurt für eine periodisch erscheinende Kulturbeilage in der Tageszeitung, zu gegenwärtig rund 60.000 € in Würzburg für die Zeitungsbeilage „Zugabe“ (daneben erscheint noch ein ebensolches Blatt des städtischen Theaters mit dem Titel „Foyer“, das natürlich vom Theater bezahlt wird), die sechs Mal jährlich mit acht Seiten das „quirrelige“ kulturelle Leben der Stadt begleitet, über 35 000 € in Bayreuth und Aschaffenburg, 20.000 € in Nürnberg bis zu 15.000 € in Erlangen für das monatlich in einer Auflage von 5000 Exemplaren erscheinende Info-Blatt „Rathausplatz 1“.
Auswirkungen auf die Presselandschaft
Allerdings sind die von den Städten gemachte Angaben zum finanziellen Aufwand des städtischen Medienengagements wenig aussagekräftig und sie sind auch kaum miteinander vergleichbar, da sich hinter dem Haushaltstitel „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, offensichtlich sehr unterschiedliche Aktivitäten verbergen. In Aschaffenburg wurden nach Aussage von Finanzreferenten Meinhard Gruber, aus dem Gesamtetat Öffentlichkeitsarbeit von über einer Million sogar schon Ausstellungen abgerechnet.
Wichtiger ist jedoch die Frage, welche Auswirkungen städtische Medienumtriebe auf die Presselandschaft überhaupt haben. Gefährden städtische Publikationen, etwa indem sie Anzeigen unter Ausnutzung von Wettbewerbsvorteilen akquirieren, mittel- und längerfristig die Existenz kleiner Verlage? Den Anzeigenakquisiteur, der im Auftrag der Stadt kommt, schickt ein örtlicher Gewerbetreibender vermutlich nicht so leicht wieder weg.
Ferner: Werden die Aufträge zur redaktionellen Erstellung, zu Druck und Distribution städtischer Medienerzeugnisse über faire Ausschreibungen abgewickelt? Das läßt sich nicht so leicht beantworten. Während man in Fürth auf Nachfrage ganz traditionell die Zahlen nennt und die Auftragsvergabemodalitäten, beispielsweise auch, daß alle zwei Jahre eine neue Ausschreibung erfolgt, muß man in Würzburg als Fragesteller unbedingt auf der Höhe der Zeit sein. Hier hat man mit der Hinwendung zum Daten-Journalismus den neuesten Trend aufgegriffen. Städtische Informationen bedienen sich sorgsam aufbereiteter Daten, die etwa als mehrere hundert Seiten umfänglicher Haushaltsentwurf haarklein im Internet einzusehen sind. Exakter geht nicht, wenn auch ungeklärt bleibt, ab welchem Betrag die Stadt einen Druckauftrag – beispielsweise für die „Zugabe“ – öffentlich auszuschreiben hätte.

Weiterhin: Werden durch die städtische Öffentlichkeitsarbeit die Arbeits- und Existenzbedingungen von angestellten und freien Journalisten erschwert bzw. gefährdet? Letzteres scheint in erheblichen Umfang der Fall zu sein, jedenfalls wird sich nach Aussage von Michael Busch, dem Vorsitzenden des Bayerischen Journalistenverbandes, sein Berufsverband verstärkt um solche Fragen kümmern. So dürfte bereits das inzwischen umfangreich praktizierte Verschicken von Fotos (wobei obendrein fast immer auf die Angabe des Urhebers verzichtet wird) zu Pressemitteilungen gegen Wettbewerbsrecht verstoßen, da Zeitungen die Bilder des Kollegen „oh“ (ohne Honorar), denen eines freien Kollegen vorziehen bzw. entsprechende Fotoaufträge nicht mehr vergeben. Oder es wird letztlich gleich auf den einen oder anderen, festangestellten Pressefotografen verzichtet, weil ja Bilder kostenlos zur Verfügung stehen.
Einerseits Digitalisierung, wodurch die Erstellung und die Verbreitung von Fotografien demokratisiert wurde, und andererseits das verlockende Angebot von schönen und kostenlosen PR-Bildern haben den Fotomarkt auch und vor allem den (lokalen) Markt für Pressefotografien völlig zusammenbrechen lassen. So zahlt beispielsweise die Würzburger Main-Post fünf Euro für ein Foto – entsprechend Auflage und Vereinbarung mit Berufsverband und Gewerkschaft müßte mindestens das Zehnfache bezahlt werden. Möglich ist dies, weil es auf die fotografische Qualität, also das, was man früher den Stil eines stadtbekannten Lokalfotografen nannte, kaum noch ankommt und die journalistische Arbeit, die lokalen Themen, über die berichtet wird, im Zweifel authentische Bilder nicht erforderlich machen. Eine Scheckübergabe ist das eine, ein Vulkanausbruch oder ein totes Flüchtlingskind am Meerufer ist das andere. Natürlich ist der Bericht (nicht unbedingt das Bild) über das tote Flüchtlingskind bedeutsamer. Und doch begeht man mit der Bewertung lokaler Ereignisse als grundsätzlich unwichtiger einen Denkfehler. Das Normale sollte eben die Sensation des Lokaljournalismus sein. Dann fiele u.U. auch auf, wie eigenartig es ist, daß es seit Jahren scheinbar nur noch wenige lokale Geschichten zu geben scheint, die die Gemüter richtig erhitzen und evt. noch vorhandene Stammtische erzittern lassen. Vermutlich liegt das aber daran, daß wir alle anständiger, moralischer, gerechter, ehrlicher geworden sind.
Öffentlich-rechtlich
Weshalb nun das alles doch recht ausführlich darstellen? Einerseits auf jeden Fall, weil in der Diskussion um Fake News, Lügenpresse, um die Glaubwürdigkeit der Medien, vor allem natürlich der Printmedien, gern an die großen, überregional bedeutsamen Zeitungen gedacht wird. Dabei bleibt weitgehend unbeachtet, daß die Krise ihre Anfänge und ihre gravierensten Auswirkungen im Lokalen und Regionalen hat. Vor allem im Lokal- und Regionalbereich erweist sich das unselige Zusammenwirken von Verlagen auf der einen Seite und Städten, Behörden, Verbänden usw. auf der anderen Seite als immer größere Gefahr für Meinungsvielfalt und Pressefreiheit. Es schleichen sich Verfahren und Umgangsformen ein, die wie Zensur wirken, die eine ohnehin nicht gern gesehene Kritik beinahe gänzlich verhindern. Deutlich wird jedenfalls, daß gerade auch die politischen Instanzen, die im eigenen Tun, Interesse an Demokratie haben sollten, Veränderungen der Presselandschaft befördern, die eben dieser Demokratie nachhaltig schaden. Dabei reagieren alle Seiten offensichtlich nur: Die Verlage auf die Digitalisierung, die ihnen die Leser abspenstig macht; die Städte auf die Medien überhaupt, die die Informationen, die sie den Bürgern zukommen lassen wollen, aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr transportieren. Selbst die Veranstaltungsmagazine verzichten auf die letzten Reste redaktioneller Texte, weil sie sich im verschärften Konkurrenzkampf Redaktion überhaupt nicht mehr leisten können und vermutlich auch nicht mehr leisten müssen. Auf der Strecke bleiben die, die überhaupt eine Meinung zum gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Geschehen gerade auch in der Provinz haben und mit ihrer Meinung einen Beitrag zum Gelingen einer demokratischen Gesellschaft leisten könnten. Vielleicht sollte man in den Städten darüber nachdenken, ob man nicht besser beraten wäre, lokale Medien, die redaktionelle Arbeit leisten, entsprechend zu erarbeitender Kriterien zu fördern, anstatt mit oft unsäglichen und unprofessionellen, eigenen Publikationen sogar virtuelle Schadstoffe zu emittieren.
Es wird in naher Zukunft kein Weg an einer öffentlich-rechtlichen Finanzierung – oder Stiftung oder Fonds oder eine Art Kirchensteuer – von seriösen Printmedien vorbeigehen. Und zwar sowohl von einzelnen Zeitungs- und Zeitschriftentiteln wie übrigens auch von Agenturen für Wort und Bild, weil wir anders selbst unsere Geschichte verlören.