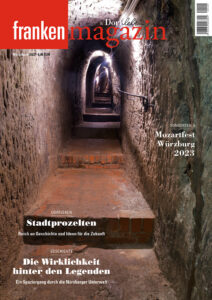Fast eine Bildergeschichte
120 Jahre Kunst- und Stadtgeschichte am Stück – die Ausstellung „Erlangen und die Kunst“ spürt der engen Verflechtung von Kunst und Stadtentwicklung nach.
Text + Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Die Idee, entlang des vergangenen Jahrhunderts dem Verhältnis von bildender Kunst und Stadtentwicklung (am Beispiel der Stadt Erlangen), eine teils kunstgeschichtlich, teils sozialgeschichtliche Ausstellung zu widmen, drängt sich vielleicht nicht unbedingt auf, zeitgemäß ist sie allemal. Sind doch im gegenwärtigen gesellschaftlichen, (welt)-politischen und kulturellen Geschehen zahllose, mitunter geradezu beängstigende Parallelen zu früheren Zeiten festzustellen, die uns alle interessieren sollten (Denken Sie an AfD bis hin zu Trump.). Etwas überschwenglich ausgedrückt wäre „Erlangen und die Kunst“ insofern bestens als Wanderausstellung durch vergleichbare bayerische oder deutsche Städte geeignet … oder ihnen wenigstens das Konzept zur Nachahmung empfohlen. Wie sehr sich diese auch immer hinsichtlich Personal, Sprache, Baustellen, Sehenswürdigkeiten, Trinkgewohnheiten oder sich womöglich nur wegen des Bildungsniveaus der zuständigen Kulturreferenten unterscheiden mögen, zumindest die Zeitläufte haben sie gemein. Und damit eben auch die darin anklingenden Probleme mit ihrer Kunst (die heute mancherorts vielen nicht einmal zur Kultur gehört, wenn man nicht danach tanzen kann). „Kunst steht immer in Beziehung zu Publikum und Kritikern, Förderern und Mäzenen, Moden und Trends, Ökonomie und Politik. Geschichte und Entwicklung der Stadt … spiegeln sich in ihrem Umgang mit Kunst, aber auch in den Kunstwerken selbst.“ So die Presseinformation zur Ausstellung, die – unter der Leitung von Museumschefin Brigitte Korn, von Helga Zahlaus und Andreas Thum aus dem eigenen Bestand des Stadtmuseums – dem „Kunststandort“ Erlangen tatsächlich wunderbar „angegossen“ wurde. (Sie muß noch bis zum 28. April 2024 besucht werden.) Die, farblich klug abgesetzt, chronologisch gegliederte Präsentation zeigt, wie sich Kunstgeschichte und Stadtgeschichte verwoben haben, ohne freilich die spezifischen Ursachen dafür erklären zu können (daran scheitern bislang ja selbst Historiker und Politologen). In der Ausstellung geschieht es diskret anhand zufällig im Depot abgehangener Filetstückchen und erlangt gerade dadurch mal mehr, mal weniger ihre überregionale Bedeutung.


Intakt war gestern, gerechter ist morgen?
Je nach Gemüt mag man sich nun für eine etwas härtere, sagen wir, ideologisch verirrte oder anklagende oder eine eher, im wahren Sinn, beschauliche Tour (die einem die Ausstellung mit ihren ca. 100 Exponaten zumindest nicht aufdrängt) entscheiden. Wenn, dann lenkt die Präsentation das Augenmerk des aufgrund der gegenwärtigen Nachrichtenlage ohnehin beunruhigten Besuchers. Angefangen mit den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen, über das europa- und weltweite Erstarken des Populismus und des Antisemitismus bis hin zu den Krisen, sei es der Demokratie, des Klimas, der Wirtschaft, Medien. All das mag das Augenmerk des Ausstellungsbesuchers auf jene, der sechs im Geschehen der damals eher kleinen, aber aufstrebenden Stadt vorkommenden Kunstepochen lenken, die zu ihrer Zeit die sich ankündigenden Katastrophen thematisierten, vielleicht nur erahnen ließen oder schließlich im Nachgang nur halbherzig bzw. nicht aufgearbeitet wurden. Letzteres z. B. verweist nebenbei auf die Frage, wie es um die deutsche Erinnerungskultur steht. (Nicht gut, aber das ist ein anderes Thema.) Wie auch immer, man kann „Erlangen und die Kunst“ als eine nachdenklich, melancholisch stimmende Ausstellung ansehen, die vieles nur beispielhaft andeuten kann; etwa die rückwärtsgewandte, von einem Teil der Stadtgesellschaft getragene Sehnsucht nach einer verklärten, heilen, intakten Welt – zu dem wohl der Erlanger Maler Peter Bina gehörte. Und daneben wird die Weltsicht eines anderen Teils der Stadtgesellschaft thematisiert, der eine manchmal utopische, gerechtere, bessere Zukunft erträumt, aber auch die Widersprüche erkennt. Daß sich beide Seiten mitunter radikalisierten, bewaffnet, unversöhnlich gegenüberstanden und sich beider Traumgebilde bislang (!?) nicht erfüllten, sollte, so sie nicht aus verbrecherischen Motiven angestrebt, gemalt waren, im Nachhinein auch gar nicht im einzelnen be- bzw. verurteilt werden. Es reicht, daß die Künstler und Künstlerinnen bzw. ihre Werke, die einstmals verlacht („Faschingsscherz“) und verfemt („entartet“) wurden und in der Ausstellung, weil sie gerade anderweitig gebraucht werden, nicht gezeigt werden können, heute Weltruhm genießen.

Nicht einmal ignoriert

Mitunter waren die großen Künstler aber in Erlangen zu sehen. Etwa die Münchner Malerin Gabriele Münter, von der 1914 der Erlanger Kunstverein 52 Gemälde zeigte. Oder Max Liebermann, Lyonel Feininger, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Käthe Kollwitz, u.a. von denen etwas später in den sog. „Überblicksschauen“ (wie „Vom Impressionismus zum Expressionismus“) Werke zu sehen waren. Oder die Arbeiten von Max Beckmann über Marc Chagall, Otto Dix, George Grosz, Paul Klee, bis hin zu Alexej von Jawlensky und Oskar Schlemmer, die unter dem Titel „Mannheimer Schreckenskammer“ 1933 als abschreckende Beispiele gezeigt wurden (die wohl „hochkarätigste“ Ausstellung, die je in Erlangen zu sehen war), also von nahezu allen noch heute weltberühmten Künstlern, die in den großen Museen der Welt von New York über Basel bis Madrid vertreten sind. Während die „gesunde Kunst“, wie sie schon 1930 auch vom Erlanger Kunstverein gefordert wurde, während die „Kunst unter dem Hakenkreuz“, von Künstlern mit „unbescholtenem Ruf, deutscher Gesinnung und arischer Abstammung“, in die völlige Bedeutungslosigkeit versunken ist und nicht einmal ignoriert werden muß – sieht man von gelegentlichen anekdotischen Ausbrüchen in die Kunstgeschichte ab, wie etwa zu Hermann Gradl oder Walter Bischoff.
Hervorzuheben ist, daß die Ausstellung im Stadtmuseum dezidiert der Situation der Künstler, ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen einer ausdrücklichen Beachtung für Wert erachtet, und zwar entlang aller Zeitabschnitte, also nicht nur während des NS-Regimes. Für einen kurzen Zeitraum (nach dem Zweiten Weltkrieg) nämlich war Erlangen regelrecht ein Eldorado der Kunst. Die Stadt hatte den Krieg unbeschadet überstanden – die Baustellenbilder, Bilder vom Bau von Hochhäusern könnten regelrecht befremden, waren sie doch tatsächlich Aufbau und nicht Wiederaufbau – und zog viele heimatlos gewordene Künstler („Ausgebombte“), ehemalige Kriegsgefangene und Geflüchtete aus den Ostgebieten an, die das Kunstleben der Stadt für Jahrzehnte prägen sollten. Der Nachholbedarf in Sachen Kunst war riesig und zumindest bis zur Währungsreform fanden Kunstwerke reißenden Absatz. Offensichtlich gab es viele freie Wände. „Die Werke aus den späten 1940er Jahren decken ein … weites Spektrum ab, das von Landschaftdarstellungen über die Verarbeitung von Eindrücken der Kriegs- und Nachkriegszeit bis hin zu religiösen Sujets reicht.“ (Presseinfo)

Bangen um die kulturellen Wegweiser

Allerdings beginnt sich schon in den 50er und 60er Jahren abzuzeichnen, was die Kunstszene mehr und mehr beschäftigte. Waren anfangs die gesellschaftlichen Strukturen vom konservativen Denken („Adenauer-Zeit“) bestimmt, vollzog sich allmählich ein tiefgreifender Wandel. Autoritäten wurden zunehmend in Frage gestellt. Die Kunstszene diskutierte über „Gegenständlich versus Abstrakt“. Die Künstler suchten nach neuen Ausdrucksformen; die kommunale Kulturpolitik entdeckte mit Hilmar Hoffmann (Frankfurt) und Hermann Glaser (Nürnberg) die kulturelle Teilhabe als Grundrecht der Menschen und Voraussetzung demokratischen Zusammenlebens. Auch in Erlangen entstanden Künstlervereinigungen, wurden Ausstellungsmöglichkeiten geschaffen. Die Szene wurde immer differenzierter, dabei – auf jeden Fall von außen betrachtet – immer unüberschaubarer.
Selbst wenn das nicht ganz korrekt sein sollte, die Ausstellung im Stadtmuseum, die Macher derselben tun sich offensichtlich zunehmend schwerer, je näher es der Gegenwart kommt, klare Linie zu bewahren. Und sie räumen dies auch freimütig ein: „Ob Digitalkunst, Street Art, Comics oder Land Art – thematisch sind heute kaum noch Grenzen gesetzt. Die Sammlung des Stadtmuseums kann diese Vielfalt nur ansatzweise abbilden.“ (Presseinformation)
Der Besucher muß selbst interpolieren, was mit einer Gesellschaft, einer Stadtgesellschaft passiert, der es an kulturellen Wegweisern gebricht. Das nämlich bedeutet das Eingeständnis der Ausstellungsmacher im Klartext, zumal die Hoffnung, mit zunehmendem Abstand und nicht zuletzt dem Einsatz moderner Technik (Digitalisierung, KI), selbst ein Chaos ordnen zu können, wohl trügerisch sein dürfte. Je mehr sich Kunst wie Museum digitalisieren, sich damit der Infokratie, der Informationsflut ergeben, desto bedeutungsloser wird die Kunst, desto unfähiger werden Museen, das ihre zu tun. Museen erzählen Geschichte(n). Mit „Erlangen und die Kunst“ ist das dem Stadtmuseum mustergültig gelungen. So perfekt, daß man beim Versuch, dies zu erfassen (wie der Autor dieses Textes) eigentlich nur versagen kann. Die 100 Exponate verlangten nämlich mindestens ein 100seitiges Werk, genaugenommen einen Roman. Aber das wäre einfach vermessen.