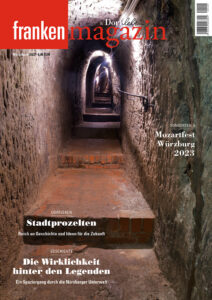Ein Photo kann man nicht beschreiben.
Die FAZ-Photographin Barbara Klemm verwandelt das Erlanger Stadtmuseum in eine Bildungseinrichtung für Fotojournalisten.
Text + Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Natürlich könnte es Zufall sein, daß am selben Tag (1.10.2021), an dem Barbara Klemm ihre Ausstellung von Pressephotographien im Erlanger Stadtmuseum eröffnet, zahlreiche deutsche Tageszeitungen ein Politiker-Selfie zum zielführenden Koalitionspoker prominent auf der Titelseite plazieren. Arbeiten aus den Jahren 1967 – 2019 einer der bedeutendsten Pressephotographinnen Deutschlands als Semiophoren (Gegenstände ohne Nützlichkeit) im Museum gegen die mit Volker Wissing, Generalsekretär der FDP, in sein Handy grienende Gang aus Annalena Baerbock und den beiden Finanzministern, Christian Lindner und Robert Habeck. Ein Höhepunkt der gegenwärtigen Deprofessionalisierung der journalistischen Meinungsbildung! Das kann kein Zufall sein, auch kein Gag der dpa, eher blanker Sarkasmus des Weltgeistes, um im kruden Gegensatz den erbärmlichen Zustand unseres Pressewesens (Demokratie?) vor Augen zu führen: Politdarsteller als bildgebende Selbstvermarkter heute; Pressephotographie (Photojournalismus) auf der anderen Seite, wie sie, freilich nur kurzzeitig, gestern noch medienprägend war? (Bereits im Herbst 1996 war das Titelthema der Zeitschrift „American Photo“ das Ende des Photojournalismus.)
Um nichts zu verklären: Tatsächlich stand der von Henri Cartier-Bresson „erfundenen“ und Robert Doisneau und auch deutschen Photographen wie etwa Jochen Blume oder Jupp Darchinger, zumeist analog und schwarz-weiß geradezu kultivierten, stets um den „entscheidenden Augenblick“ bemühten Pressephotographie nur ein schmales Zeitfenster von einigen Jahrzehnten zur Verfügung, um mit Reportagen und Nachrichtenbildern halbwegs aufklärend oder sagen wir: zumindest im landläufigen Verständnis Wissen bestätigend (Photographie als Wahrheitsähnlichkeit) zu wirken.
Das Fünkchen Zufall

Barbara Klemm hatte das Glück, sich noch unter die, in diesem von den 1940er bis längstens in die 1990er Jahre geöffneten Zeitfenster tätigen Großen des Metiers (unter denen es selbstverständlich etwa mit Lee Miller, Helen Levitt, Margaret Bourke-White oder auch Erika Groth-Schmachtenberger bedeutende Photographinnen gibt) einreihen zu können. Vielleicht nicht ganz vorne, was weniger der mangelnden Finesse ihrer Arbeit als eher den Wechselfällen des Lebens geschuldet sein dürfte. Oder nach dem Philosophen Walter Benjamin („Kleine Geschichte der Fotografie“), dem „Fünkchen Zufall (…) mit dem die Wirklichkeit den Bildcharakter gleichsam durchsengt hat“ und dessen Existenz „im Zeugnis für die Kunst des Photographen (…) nicht aufgeht“. Zufall, wie er in der Pressephotographie eben keine unbedeutende Rolle spielte – und sei es, weil kein Auftraggeber (seit 1970 fest für die FAZ) die 1939 geborene Photographin in den Vietnam-Krieg (1955 – 1975) schickte. Die ganz großen Namen im Photojournalismus – etwa Robert Capa, Martin Parr, Sebastiao Salgado oder James Nachtwey – werden stets mit atemberaubenden Reportagen verbunden bzw. mit (manchmal auch fragwürdigen) „Ikonen“, die im Rahmen von Reportagen und oft monatelangen Arbeiten an einem Thema, entstanden.
Die Tageszeitung stellte andere Anforderungen; hier ging es (und sollte es eigentlich heute noch gehen) um Nachrichten. Diesbezüglich hat sich Barbara Klemm zweifellos das Verdienst erworben, den „Bedeutungshorizont des Wortes Nachricht erweitert“ zu haben (Lothar Müller SZ vom 20.12.2013). Die Ausstellung im Stadtmuseum präsentiert nun eine Anzahl ihrer großartigen Nachrichtenbilder, die – das ist allerdings sogleich festzuhalten – natürlich die Nachrichten nicht ersetzen können. Und die im Gegensatz zu den, in den legendären Zeitschriften „Life“ oder „Paris Match“ abgedruckten Reportagen (von anderen Photographen) aus Konzentrationslagern, von Völkermord, Massakern und Kriegen nicht von Grauen und Schrecken künden, sondern zivilere Momente des Zeitgeschehens überliefern. Nur, während eine Reportage über den Völkermord in Ruanda, über My Lai oder die Befreiung eines KZs in einem Buch oder einer Ausstellung nicht selten auf (ausführlichen) erklärenden Text verzichtet – jedenfalls wird dies immer wieder getan – können und sollten Nachrichtenbilder nicht auf ihren Kontext verzichten.
Die Botschaft ohne Code
Auf Wunsch der Photographin hat man das aber im Erlanger Stadtmuseum getan – anders als übrigens, wie Lothar Müller betont, in ihrer Ausstellung 2013 im Gropius-Bau in Berlin. Fraglich, ob sich Barbara Klemm mit dem Verzicht auf den Text für bzw. mit dem das Bild tatsächlich Verwendung fand, einen Gefallen tut. Vermutlich erliegt sie nun jenseits ihres aktiven Berufslebens, in dem sie sich stets gegen Farbe („Schwarz-weiß ist Farbe genug.“) und am Ende natürlich auch entschieden gegen die Digitalfotografie verwahrt hat und das ein seriös-journalistisches war, einem modischen wie vielleicht auch akademischen Verständnis von Fotografie, das ihre Arbeit nicht entwertet, aber für den Ausstellungsbesucher kryptischer macht; er sieht an einigen Bildern die offensichtlichen Unterschiede zur zeitgenössischen Fotografie in den Medien und wird u.U. einen unerheblichen photographischen Bedeutungsüberschuß (Kleidung usw.) aufspüren.

Die Fragen, warum etwas eine Nachricht war und was überhaupt eine Nachricht ist bis hin zu der wenigstens den Connaisseur beschäftigenden, wie sich die Berufswelt von Journalisten/Photographen gewandelt hat, können ohne erhellende Texte nicht verstanden werden. Der lange geradezu kanonisierte Gegensatz zwischen realistischer/dokumentarischer/journalistischer Photographie und der künstlerischen Fotografie jedenfalls ist spätestens mit der dubitativen Digitalfotografie für jeden ersichtlich aufgehoben. Theoretiker wie Roland Barthes und Rosalind Krauss hatten allerdings schon vor der Pixelinvasion der Photographie eine ursprüngliche Bedeutungslosigkeit attestiert. Barthes spricht von der „Botschaft ohne Code“, was bei ihm in das Paradox führt, daß er an einem Wirklichkeitsbezug der Photographie festhält, der jedoch nicht dechiffrierbar, grundsätzlich nicht lesbar ist. Für Pierre Bourdieu hat die Photographie keine spezifischen Qualitäten (aber er bindet sich noch an den Stand der Technik). Ihr (vermeintlicher) Realismus erweist sich als bloße Konvention; „der Schein des Objektiven und Realistischen kommt einzig dadurch zustande, daß man sich an die Wirkungsmacht einer Illusion gewöhnt hat. Im täglichen Umgang mit Fotografien kehrt diese Illusion verläßlich wieder, bestätigt sich immer wieder selbst und erscheint auf diese Weise schließlich als natürlich“ (Peter Geimer: Theorien der Fotografie, S. 77). Die Photographie ist für Bourdieu Ausdruck und Symptom ihres sozialen Gebrauchs. Es gibt keine Identität der Photographie/Fotografie, es gibt lediglich gesellschaftlich determinierte Gebrauchsweisen (ebenda S. 78). Jenseits ihres Gebrauchs gibt es nichts, was sich über sie sagen läßt. Entscheidend ist ihr automatisches Entstehen. Etwas spöttisch kann man behaupten, der Photograph weiß eigentlich gar nicht, was er photographiert. Diese partielle Abwesenheit des Menschen, scheint den besonderen Status der Photographie zu begründen.
Das Photo, entsprechend auch das Nachrichtenbild, hat seine Berechtigung nun nicht mehr als Dokument, als Zeugnis eines Geschehens, sondern nur mehr als freilich grundsätzlich manipuliertes „Kunstwerk“, das jeder Betrachter nach eigenem Gusto versteht. Das Photo ist kein Abdruck, keine Spur, kein Index eines Wirklichen.

Eigentlich eine wichtige Ausstellung
Photographien werden nachträglich codiert, es wird ihnen Bedeutung zugewiesen. Der amerikanische Künstler und Kritiker Allan Sekula radikalisiert diese Position. Für ihn stellt ein fotografisches Bild prinzipiell eine unvollständige Äußerung dar, da es aus sich heraus keine Bedeutung hervorzubringen vermag (Geimer S. 89). Für Sekula ist die Bedeutung im strengen Sinne eine Erfindung. Während Barthes und Krauss einen „Nullpunkt des Bedeutens, aber eine physische Einschreibung des Realen“ voraussetzen, die für sich genommen bedeutungslos ist, aber die Grundlage des Bedeutens bildet. Die unhintergehbare Basis verschiedener Lesarten einer fotografischen Botschaft, beruht für Sekula auf einer tendenziösen Rhetorik.
Sekulas Fototheorie, so Geimer, verschiebt die Aufmerksamkeit gänzlich vom fotografischen Bild auf den fotografischen Diskurs. Das macht es etwas schwieriger die besondere Qualität der Arbeiten von Barbara Klemm aufzuzeigen, jedoch muß es hier vor allem um den fotografischen Diskurs gehen. So braucht man mit Sekula eigentlich nicht zwischen analoger und digitaler Fotografie (darauf kann hier auch nicht eingegangen werden) zu unterscheiden – eventuelle Bildmanipulationen können als Petitesse übergangen werden und waren in der analogen Welt ebenfalls möglich, allerdings so schwierig, daß sie kein Massenphänomen wurden. Ganz nebenbei: Es müßte zunächst einmal einen Diskurs geben, der halbwegs verbindlich festschreibt, was Bildmanipulation überhaupt sein soll. Für Sekula wäre jedoch die Vorstellung einer Einschreibung von Bedeutung, die jeder Codierung vorausgeht, … „Ausdruck einer bürgerlichen Folklore, die dem fotografischen Bild den legalen Status eines Dokumentes und eines Zeugnisses zuerkennen will und es auf diese Weise mit der mythischen Aura der Neutralität umgibt“ (siehe Geimer, S. 90). Man darf anfügen, daß sogar klandestine Versuche seitens verschiedener Presseagenturen, Manipulationen zu verhindern, ordentlich gescheitert sind. Inzwischen sind „Bildmanipulationen“ (z. B. HDR), die vor zehn, fünfzehn Jahren indiskutabel gewesen wären, fast an der Tagesordnung. In den meisten Fällen heißen sie nicht einmal mehr so. Nur gelegentlich werden krasse Fälle etwa bei internationalen Pressefotowettbewerben gerügt. Andererseits hatte Roland Barthes bereits 1957 (Mythen des Alltags) am Beispiel der Pressefotografie, die ein „ausgefeiltes, ausgewähltes, strukturiertes und konstruiertes Objekt“ darstellt, das nach professionellen, ästhetischen oder ideologischen Normen behandelt wird, die allesamt Konnotationsfaktoren (denen also stets Bedeutung zugeschrieben wird) sind, mit einem Pressekodex vereinbar, von „überkonstruierten“ Photos gesprochen. Er meinte damit beispielsweise Schockfotos von Hinrichtungen, bei denen der Fotograf dem bloßen Faktum die „intentionale Sprache des Schreckens“ hinzufügt.
Die ursprüngliche „Botschaft ohne Code“ wird von einem konventionellen Code des Schreckens überformt. Entsprechendes geschieht auch im Falle der „Pose“ oder eben überhaupt mit der Bildmanipulation. Das ist, was die Ausstellung von Barbara Klemm so wichtig macht. Nicht nur in ihrem unbedingten Bestehen auf Schwarz-Weiß, ihrem weitgehenden Verzicht auf Blitzlicht, ihrem nie unangemessen wirkenden Abstand (nie aufdringlicher Nähe) zum Geschehen und natürlich dem Erfassen des entscheidenden Augenblicks … Barbara Klemm zeigt sich in ihren Arbeiten durchweg als aufrichtige, glaubwürdige, ihrem Berufsethos verpflichtete, große Photographin.
Zu spät geborene Kolleginnen und Kollegen werden beim Gang durch die Ausstellung aber vermutlich feststellen: Viele der hier ausgestellten Bilder wären heute auch einer Barbara Klemm nicht mehr möglich. Aber das ist eine andere Geschichte. (bis 16.Januar 2022)