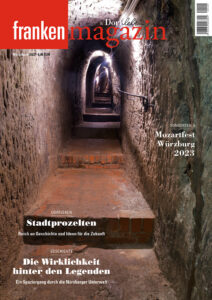Der Weg des Bogens
Die Bayerische Meisterschaft im Kyudo ist wohl einer der stillsten Wettkämpfe, die es gibt.
Text: Vanessa Michaeli | Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Daniele Bufe kniet auf dem Boden der Kürnachtalhalle in Würzburg. In seiner linken Hand hält er zwei Pfeile und einen riesigen Bogen, mit rechts greift er nach der Sehne. Konzentriert blickt er nach vorne, schließlich erhebt er sich. Stehend stützt Bufe den Bogen auf seinem Bein ab, führt den ersten Pfeil in die Sehne und richtet seine linke Hand, auf der der Pfeil aufliegt, am Bogen aus. Er hebt Pfeil und Bogen bis über seinen Kopf, wartet kurz und spannt anschließend die Sehne in zwei Schritten erst zur Wange und dann bis hinter sein Ohr. Sein ganzer Körper ist angespannt, sein Blick geradeaus gerichtet. Ein paar Sekunden hält er die Pose – dann fliegt der Pfeil und landet mit einem lauten Peng in der 28 Meter entfernt stehenden Zielscheibe.
Das Peng ist an diesem Frühlingstag Ende April regelmäßig in der Kürnachtalhalle zu hören. Es ist fast der einzige Laut, neben leisen Gesprächen und dem Vogelzwitschern, das von außen in die Halle dringt. Die Bayerische Meisterschaft im Kyūdō ist wohl einer der stillsten Wettkämpfe, den es in der Welt des Sports gibt.
Sehr, sehr, sehr trainingsintensiv
Kyūdō bedeutet übersetzt „Der Weg des Bogens“ und ist japanisches Bogenschießen. Es hat sich aus den Waffentechniken der Samurai entwickelt und gehört wie Judo oder Karate zum Budō, den japanischen Kampfkünsten. Neben der Kampftechnik – in diesem Fall dem Bogenschießen – ist vor allem die innere Leere wichtig für die Kyūdōka. So nennen sich die Menschen, die Kyūdō ausführen. „Wir leben die Philosophie, daß nicht der Bogen verbessert wird, sondern wir uns selbst verbessern“, sagt Wolfgang Strobel, Kyūdō-Trainer und langjähriges Mitglied des Würzburger Kyūdō-Vereins Main-Dojo.
Der japanische Bogen wird Yumi genannt und wurde seit dem 16. Jahrhundert kaum verändert. Lediglich die Materialien, aus denen er hergestellt wird, wurden erweitert: Neben Bögen aus Bambus gibt es heute auch welche aus anderen Hölzern, Fiberglas oder Carbon. Im Gegensatz zu westlichen Sportbögen hat der japanische keine Zieleinrichtung und keine Pfeilauflage – er verlangt also pure Handarbeit. Zudem ist ein Yumi asymmetrisch geformt. Der obere Teil nimmt etwa zwei Drittel der Länge ein, der untere ein Drittel. Dadurch läßt sich zum einen die Sehne besonders weit ausziehen, zum anderen kann der Pfeil so sehr schnell fliegen.
Die Bewegungen, die Daniele Bufe vor und nach dem Schießen des Pfeils macht, folgen einem strikt vorgegebenen Ablauf. Über acht zeremonielle Bewegungsphasen hinweg muß Bufe seine Körperhaltung und -spannung koordinieren. Weicht er davon ab, gibt es nicht nur Punktabzüge: Er könnte auch sich und andere verletzen. Denn der Langbogen, mit dem Bufe schießt, mißt 2,20 Meter. Die Spannung, die sich beim Ziehen der Sehne aufbaut, ist enorm. Es erfordert einiges an Übung, diese Kraft zu kontrollieren.
„Die Ausbildung ist sehr, sehr, sehr trainingsintensiv“, sagt Strobel. Aufgrund der Verletzungsgefahr beginne man das Training mit einer Zwille. Erst wenn ein gewisses technisches Können erreicht sei, dürfe man mit dem Bogen üben und auf einen drei Meter entfernt stehenden Strohballen schießen. Dabei trainiere man die Technik so lange, bis man bereit sei, die Schülerprüfungen abzulegen, die sogenannten Kyū-Prüfungen. Sind die ersten beiden der insgesamt fünf Kyū bestanden, wird auf die reguläre Distanz von 28 Metern geschossen. Nach durchschnittlich zwei Jahren Training haben die meisten ihre Technik so weit verfeinert, daß sie bei ihrem ersten Wettkampf mitmachen können. „Es ist eine ewige Entwicklung, die immer feiner wird“, so Strobel.

1200 aktive Kyūdōka in Deutschland
Als Trainer versucht Strobel, die japanische Tradition unverfälscht weiterzugeben. Dafür hat er selbst jahrelang geübt, seit fast 20 Jahren geht er in Würzburg den Weg des Bogens. Nach den fünf Kyū-Prüfungen legte er drei der acht Dan-Prüfungen ab und machte eine zweieinhalbjährige Trainerausbildung. Das Wort Dan bezeichnet die Meistergrade in den asiatischen Kampfkünsten. Sie erfordern Stück für Stück feinere motorische und geistige Fertigkeiten. Die Prüfungen finden einmal jährlich in wechselnden europäischen Städten statt und werden von japanischen Lehrern, den sogenannten Senseis, abgenommen.
Kyūdō ist ein Nischensport. Es wurde 1969 bei einem Einführungsseminar in Hamburg vorgestellt und hat sich von dort in andere deutsche Städte verbreitet. Laut Angaben des Deutschen Kyūdō Bunds gibt es heute etwa 1.200 aktive Kyūdōka in Deutschland. Sie organisieren sich in kleinen Vereinen wie dem Main-Dojo Würzburg. Der Verein besteht seit 1999, er hat 26 Mitglieder und ist einer von gerade mal zehn in Bayern. In den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es keinen einzigen Kyūdō-Verein. Zum Vergleich: Allein dem Bayerischen Fußball-Verband gehören über 1,6 Millionen Mitglieder in mehr als 4 500 Vereinen an.
Wer Kyūdō machen möchte, muß also teilweise weite Strecken zurücklegen. Auch Daniele Bufe fährt fast 40 Kilometer zum Training nach Würzburg – und wieder zurück. Was macht Kyūdō so besonders, daß er das zweimal die Woche auf sich nimmt? „Nach einer Verletzung konnte ich kein Karate und kein Aikidō mehr machen“, erzählt Bufe. Über 15 Jahre habe er diese Sportarten gemacht, die wie Kyūdō zu den japanischen Kampfkünsten gehören. „Mir hat eine Budō-Disziplin in meinem Leben gefehlt“, so Bufe weiter. Er erinnerte sich an einen Urlaub in Japan, bei dem er das erste Mal mit Kyūdō in Berührung kam, suchte nach einem Verein in der Nähe und war schon nach dem ersten Training Feuer und Flamme.
Auch bei Barbara Neitzel hat Kyūdō sozusagen eine Sehnsucht gestillt. Neitzel ist die erste Vorsitzende des Vereins Main-Dojo und seit etwa zwölf Jahren begeisterte Kyūdōka. „Ich war schon als Schülerin am Bogenschießen interessiert“, sagt Neitzel. „Aber das westliche Bogenschießen hat mich nicht fasziniert.“ Als Erwachsene ist sie irgendwann auf den Benediktushof in Holzkirchen aufmerksam geworden, einem spirituellen Zentrum für Meditation und Achtsamkeit. Dort hatte Barbara Lemke, die „Grand Dame des Kyūdō in Deutschland“, ein Kyūdō-Schnupper-Wochenende angeboten. Neitzel machte mit – und war sofort angetan. Zurück in Würzburg meldete sie sich gleich bei Main-Dojo und wurde Mitglied.

Zweiter Platz – ein schöner Erfolg
„Kyūdō ist eine sehr gleichberechtigte Sportart“, sagt Neitzel. Neben der Muskelkraft seien vor allem die feinmotorischen Bewegungen und deren Koordination wichtig, weshalb der Sport gleichermaßen für Männer und für Frauen geeignet sei. Auch werden Frauen und Männer weder im Training noch bei Wettkämpfen voneinander getrennt. Die Teams sind gemischt und alle werden gleich bewertet. Zudem tragen alle die gleiche traditionelle Kleidung, bestehend aus einem Hosenrock (Hakama), einem Trainingshemd (Keiko Gi), einem Wickelgürtel (Obi), einer Fußbekleidung (Tabi) und Latschen. Letztere werden jedoch nicht auf der Wettkampffläche getragen. Auch in der Kürnachtalhalle sind Ende April beide Geschlechter vertreten. Daniele Bufe tritt im Team mit zwei weiteren Würzburger Vereinsmitgliedern an, Maria Reimann und Vitali Klink. Die beiden stehen in der Halle neben ihm und vollführen die gleichen, langsamen Bewegungsrituale wie er – allerdings um Sekunden verzögert. Wie in einem Kanon gibt es festgelegte Zeitpunkte, wann der oder die nächste im Team die darauffolgende Bewegungsphase beginnen darf. Neben dem Konzentrieren auf den eigenen Körper gilt es hier, auch auf die anderen zu achten. „Das Team bewegt sich in vollständiger Harmonie miteinander“, erklärt Trainer Strobel.
Die langsamen Bewegungsrituale und die Konzentration, die sie erfordern, sorgen für eine andächtige Stimmung in der Kürnachtalhalle. Welche Kyūdōka man auch anschaut: Sie alle strahlen feierliche Ruhe und Achtsamkeit aus – egal, ob sie wie Daniele Bufe gerade schießen oder ihren Gegner-Teams zuschauen. Trotzdem vergißt niemand, daß es an diesem Tag darum geht, das jeweilige Können zu messen. Der Main-Dojo Würzburg belegte im Mannschaftswettbewerb der Bayerischen Meisterschaft den zweiten von sechs Plätzen, im Einzel landete Oliver Pamperin auf Platz drei von fünf. „Ein schöner Erfolg“, zieht Vorsitzende Neitzel Bilanz.