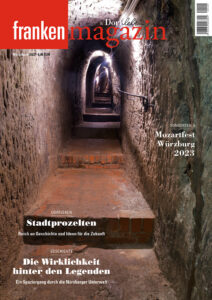Der Letzte seiner Art
Wie Holzkohle entsteht – Wir haben dem Köhler Gerhard Sommer bei seiner Arbeit zugesehen.
Text + Fotos: Lothar Mayer

Furth ist ein kleines, aber ganz besonderes Walddorf im südlichen Nürnberger Reichswald.
Urkunden belegen, daß Furth schon seit mindestens 650 Jahren existiert. Nähert man sich der Gemeinde von Sperberslohe, also von Osten her, begrüßt ein Graffito den Besucher. Aha, denkt man, hier geht‘s nicht grad bierernst zu.
Auch beeindrucken mehrere Häuser rechter und linker Hand. In den etwa 30 Häusern leben rund 80 Menschen. Und noch etwas fällt auf: Die Arbeit eines ortsansässigen Kunsthandwerkers. Ihm geht es mit seinen Installationen offenbar darum, den Besucher zu erfreuen und ihm auch die mittelfränkische Mundart etwas näher zu bringen.
Besucht man Furth im Mai wird man oft von einem speziellen Geruch begrüßt, der bei der Verschwelung von Holz zu Holzkohle entsteht. Ja, wir sind in einem Köhlerdorf angekommen – dem letzten im Nürnberger Reichswald. Für die allermeisten Further ist dieser Geruch ein olfaktorisches Sinneserbe – so riecht unsere Heimat; wenigstens für einige Wochen im Frühling. Das Empfinden von Heimat ist eben mit allen Sinnen verbunden – auch mit dem Geruchssinn.
Seit einigen Jahren wird die Further Köhlerei nur noch von der Familie Nerrether und von Gerhard Sommer betrieben und von den Brennplätzen am Ufer des Hembach ist nur noch der der Sommers geblieben. Ich wollte den Vorgang der Holzkohleerzeugung dokumentieren, und ich wollte auch miterleben, was es körperlich bedeutet, einen Kohlemeiler aufzubauen und abzuernten. Der Köhler Gerhard Sommer willigte in mein Ansinnen ein …


… und wir starteten mit der Arbeit.
Zunächst werden vier Holzstangen in die Erde getrieben, mit Brettern vernagelt und so stabilisiert. Das zukünftige Heizloch oder wie man früher sagte – der Quandel oder Quandelschacht. Anschließend wird ein Holzfundament ausgelegt. Auf diese Weise wird etwas Bodenfreiheit geschaffen und für eine gewisse Kaminwirkung gesorgt. Ja, und dann beginnt der Köhler mit dem Aufbau des Meilers.
Zuerst werden etwa ein Meter lange Holzscheite um das Heizloch herumgruppiert. Je mehr Hände zugreifen, um so schneller geht die Arbeit vonstatten. Vorteilhaft ist es, wenn z. B. ein Frontlader die Holzscheite direkt zum Meilerplatz transportiert. Hat der Meiler einen Durchmesser von etwa zwei Metern, wird mit kürzeren Scheiten in die Höhe gebaut.


Bis zum Ende des 1. Arbeitstages
Am nächsten Tag werden an der Meilerbasis kürzere Scheite angebaut und auf dieses Weise der Meiler vergrößert. Zur Zwangsbelüftung des Meilers fügt man auf jeder Seite je ein Ofenrohr ein. Weitere Belüftungsschlote werden später gestochen. Ist das schließlich geschafft, wird der Meiler mit Heuballen abgedeckt. Man kann auch Fichtenwedel, Grassoden, Stroh oder anderes Abdeckmaterial verwenden. Die Abdeckung ist notwendig, damit die Erde, die für eine weitgehende Abdichtung sorgen wird, nicht zwischen den Holzscheiten verschwindet. Nun wird der Meiler mit einer etwa 10 cm dicken Erdschicht abgedeckt; vielleicht die anstrengendste Arbeit. Und wenn einige Jahre kein Meiler angefeuert wurde, durchwurzelt das Erdreich und macht die Arbeit noch etwas anstrengender.

Ein beinahe religiöser Moment
Der Meiler wird angeheizt. Zunächst baut der Köhler eine kleine Holzpyramide aus getrockneten Holzscheiten, zündet sie an und schiebt schließlich die Glut vorsichtig in das Heizloch. Das ist aber erst der Anfang. Jetzt muß das Feuer gefüttert werden. Sack um Sack, gefüllt mit Hackschnitzeln wird in den Schacht gefüllt, der immer wieder mit einer schweren Eisenplatte verschlossen werden muß.
Nun kann der Verschwelungsprozeß endlich beginnen, obwohl ein schweres Gewitter aufgezogen ist und dicke Regentropfen fallen. Was anschließend kommt, ist vor allem Köhlersache und getragen von Erfahrungswissen. Und es ist harte Köhlerarbeit: Mit einem Holzklöppel wird die Erde angeschlagen, damit sie nicht abrutschen kann und zudem verdichtet wird. Der Meiler soll ja nur die Luft bekommen, die ihm der Köhler zubilligt. Es dauert ungefähr eine Woche bis das Holz zu Holzkohle geworden ist.
Genug Zeit, in Furth erst mal einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern auf einem großen, ehemaligen Brennplatz, der heute als Ort der Stille und Besinnung genutzt wird. Ein beinahe religiöser Moment. Anschließend gibt es den Köhlerfrühschoppen. Alles ist bestens organisiert. Für alle anfallenden Arbeiten sind die Further Köhlerfreunde zuständig. Die Köhlerei und die Köhlerfreunde sind jedenfalls wichtige Strukturelemente der Further Dorfgemeinschaft und bedeutungsvoll für die Definition von Heimat.
In den Tagen bis zur Ernte, muß der Köhler immer wieder an Ort und Stelle sein, um sicherzustellen, daß die Belüftung stimmt und um lokale Feuerherde innerhalb des Meilers sofort zu löschen. Im Meiler herrscht immerhin eine Temperatur von etwa 600 °C.
Die Kunst des Köhlers besteht eben genau darin, dem Meiler gerade so viel Luft zuzuführen, daß er weder erlischt noch abbrennt. Und auch der Meilerplatz muß einigen Anforderungen genügen. Die Anfuhrwege für das Holz sollten kurz, der Platz windgeschützt und es muß Wasser in der Nähe verfügbar sein. Einerlei, ob das Wasser aus einem Faß oder einem Bach kommt.

Kohle für Kohle
An der Farbe des Rauches erkennt der Köhler schließlich, wann der richtige Zeitpunkt zum Öffnen des Meilers und zum Ernten der Holzkohle gekommen ist. Und wieder werden die Köhlerfreunde aktiv, denn die Ernte ist eine Arbeit, bei der viele Hände gebraucht werden.
Das Volumen des Meilers hat sich deutlich reduziert. Normalerweise muß weit vor der Ernte gewässert werden, damit es etwas zu ernten gibt. Diesmal muß man während der Ernte wässern, denn im Meiler glüht es, und die Kohle kann brennen, wenn sie mit Sauerstoff in Berührung kommt. Mit einer Art Misthacke zieht der Köhler die Holzkohle aus dem Meiler heraus, die Helfer breiten sie mit einer Kartoffelgabel aus und löschen die Glutnester. Der ganze Vorgang dauert, je nach Mannschaftsstärke, einige Stunden bis zu einem Vormittag.
Schließlich liegt die Holzkohle ausgebreitet auf dem Meilerplatz. Nun gibt es für alle eine Brotzeit und im übrigen gilt für die Helfer der fränkische Imperativ: ……..
Wenn die Kohle gut abgekühlt ist, wird sie in Papiersäcke gefüllt. Nun muß sie noch Käufer finden, damit Kohle ins Haus kommt. Gewissermaßen: Kohle für Kohle … Unser Meiler hatte eine Größe von etwa 20 Ster. Aus einem Ster Holz werden etwa 70 bis 80 kg Holzkohle. Im Köhlerwald blüht der Fingerhut, und die Köhler-Lieseln versammeln sich zum Further Köhler-Kaffee-Klatsch, und auch die Grillsaison hat längst begonnen. Heutzutage wird Holzkohle vor allem von Fisch-, Wurst- und Fleischbrätern benötigt. Schließlich, was wäre Grillen ohne echte Holzkohle?

In früheren Zeiten hingegen war die Holzkohle für viele Industriezweige enorm wichtig.
Bis ins 18. Jahrhundert war es nur mit Holzkohle möglich, genug Hitze zu erzeugen, um in Brennöfen Eisen zu verhütten oder Glas herzustellen. Die Goldschläger und Nadelmacher in Schwabach und auch die Drahtzieher in Roth kamen ohne Holzkohle gar nicht aus. Für einige Filtertechniken wird auch heute noch Holzkohle eingesetzt und auch für die Schwarzpulverherstellung ist sie von Bedeutung. Und der Einsatz der Holzkohle in den Schmieden liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Vor allem aber: Die erste Eisenbahn, die am 7. Dezember 1835 von dem stolzen William Wilson vom Nürnberger Plärrer nach Fürth gesteuert wurde, wäre ohne Holzkohle bestimmt nicht so zügig unterwegs gewesen. Im Vergleich zu getrocknetem Holz hat Holzkohle eben einen etwa doppelt so hohen Heiz- oder Brennwert. Das alles war jedenfalls Grund genug, das Köhlerhandwerk im Dezember 2014 in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufzunehmen.
Nun, von Osten sind wir gekommen und in Richtung Westen verlassen wir das Köhlerdorf Furth. Aber wir werden wiederkommen, spätestens zur nächsten Brennperiode.