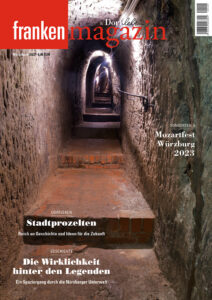Das Fünfte Buch
Eine Podiumsdiskussion des Bayerischen Journalistenverbandes im Rudolf-Alexander-Schröder-Haus in Würzburg zur Zukunft des Lokaljournalismus. (Lesezeit ca. 10 Minuten)
Text + Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Schlimmer hätte es kaum kommen können. Für den Liberalismus nicht; für den in Unterfranken einfach nicht tot zu kriegenden Investigationsjournalismus; und auch nicht für eine geradezu aufreizend dahinsiechende Podiumsdiskussion über die Zukunft des Lokaljournalismus: Alles ist gut! Eigentlich! Abgesehen vielleicht von den tarifpolitischen Tricksereien eines hiesigen Verlagshauses. Abgesehen von sittenwidrigen Honoraren für freie Mitarbeiter. Abgesehen von der, im journalistischen Bereich, sich irgendwie vielversprechend anhörenden „Verdichtung“ am Arbeitsplatz. Schließlich sogar abgesehen von den Möglichkeiten, trotz Google mit Inhalten, also: Content, im Netz Geld zu verdienen.
In Sachen Problemanschneiden ließ die Veranstaltung des Bayerischen Journalistenverbandes (BJV) Mitte April im Würzburger Rudolf-Alexander-Schröder-Haus kaum zu wünschen übrig. Ernsthafte Probleme für den (fränkischen) Journalismus scheint es danach aber nicht zu geben. Wie auch? Dominierten doch die Chefredakteure der beiden großen unterfränkischen Tageszeitungen, Michael Reinhard (Main-Post Würzburg) und Martin Schwarzkopf (Main-echo Aschaffenburg), den herrschaftsfreien Diskurs auf dem Podium.
Eberhard Schellenberger, BR-Redaktionsleiter Hörfunk (Würzburg), hingegen konnte sich leibesgegenwärtig und vergnügt aus dem Verlagsgeschmachtel raushalten. Beim BR herrschen – im Vergleich zu den Printmedien – noch immer himmlische (weiß-blaue) Zustände. Und das „normale“ Programm BR 2 (hört man beim „Zündfunk“-Geschwafel weg) wiegt sogar das „updaten“ des Wetters auf den übrigen Kanälen auf. Der Vertreter des Journalismus 2.0, der einstige Würz-Blogger Ralf Thees, war in seinem Volontariat bei der Main-Post noch nicht für substanzielle Beiträge ausgebildet. Und die Vertreter des Berufsverbandes? Der unterfränkische Bezirksvorsitzende Daniel Staffen-Quandt (Moderator) und der Landesvorsitzende Michael Busch mochten den Empathieakrobaten der beiden Zeitungen nicht die Performance verderben.

Dabei: Etwas Klartext, ein wenig Kontroverse, selbst angesichts einer Vielzahl sich trefflich aufs senkrechte Kriechen verstehende Redaktionsboten im Auditorium, wäre der Sache sicher dienlich gewesen. Stattdessen entschuldigte Michael Busch mehrfach, daß er „keinen Widerspruch“, sondern allenfalls Akzente zu setzen hätte. Etwa wo er im Bemühen von Ämtern, Behörden, Kommunen, redaktionellen Einfluß zu nehmen, eine größere Gefahr für die Pressefreiheit erblickte, als in der Abhängigkeit der Medien von Anzeigekunden, die es nach Aussage der unbestechlichen Chefredakteure ohnehin nicht gebe.
Gibt es Lokaljournalismus überhaupt noch?
Am Ende hätte nicht viel gefehlt und Reinhard und Schwarzkopf hätten selbst Kritik an der makellosifizierten Verlagspolitik ihrer Häuser geäußert, um sich nicht unentwegt gegenseitig zu gefallen. Immerhin fanden sie so Gelegenheit, jungen Menschen den „schönsten Beruf der Welt“ zu empfehlen, selbst wenn (sinngemäß!) natürlich nicht jeder Chefredakteur werden könnte.
Nur für notorischen Schwarzsehern interessierende Fragen reichte die Zeit eben nicht: Gibt es Lokaljournalismus überhaupt noch? Wache Zeitgenossen bestreiten dies inzwischen vehement. Und wenn: Ist Lokaljournalismus auch nur annähernd noch, was er zumindest in einer verklärenden Retrofiktion einmal war? Macht es angesichts von Facebook, Twitter, demnächst einem Freihandelsabkommen (TTIP), der Veräußerung jeder Kläranlage an internationale Konzerne, die dann die Stadtplanung profitabel gleich mit übernehmen, angesichts von Überwachungsstaat und Kanadagänsen andererseits, macht es da überhaupt noch Sinn auf Lokaljournalismus zu bestehen? Geht es vielleicht auch anders?
Es ist, zumindest für einen kurzen Moment, eine charmante Idee, den Bulletins der Kleintierzüchter, überhaupt der örtlichen Vereine bis hin zu Pfarreien und Verbänden, eben all den Nachrichten, die man schon in einem einstigen Generalanzeiger zähneknirschend für unverzichtbar hielt, ein eigenes Buch – im Zeitungsjargon die Seiten, die zusammen gedruckt werden und oft einem Ressort gehören – zur Verfügung zu stellen. Über kurz oder lang wird man diesem „Fünften Buch“, so umschmeichelt es das Aschaffenburger Mainecho, vermutlich sogar die den journalistischen Mindeststandard selbstredend genügenden Meldungen aus Rathäusern und Amtstuben zuordnen können; hat man doch die abtrünnigen Journalisten, die Pressesprecher und PR-Autoren einst selbst ausgebildet.
Und da es sich bei dem Fünften Buch, wie der Mainecho-Chef Martin Schwarzkopf, auf der Podiumsdiskussion andeutete, obendrein um einen Hybriden handelt, kriegt man noch wohlfeile Qualität in den eigenen Netzauftritt. Das Fünfte Buch wird nämlich nur gelegentlich gedruckt. Vorrangig handelt es sich um eine Art Blog bzw. um den von Lesern und Abonnenten und Pressesprechern (?) aufgefüllten Teil der Internetausgabe der Tageszeitung. Das alles geschieht natürlich nicht nur aus fürsorglicher Heimatliebe, sondern weil alle davon profitieren: Die Gazettiers haben ihr Auskommen, Firmen-, Verbandschefs, Repräsentanten und Politiker bekommen in den Mund gelegt, was sie schon immer mal sagen wollten, und die Verlage können kostengünstig die freilich zunehmend größer werdenden Lücken zwischen den Anzeigen mit ganzen Sätzen auffüllen.
So etwa! Auf Nuancen kommt es gar nicht mehr an. Tatsächlich offenbart ein solches Fünftes Buch – etwas überspitzt – also das ganze Elend des Lokaljournalismus. Dabei könnten allein schon die sich manchen aufdrängenden, gewichtigen Assoziationen ahnen lassen, was man hier eigentlich verschenkt. Mag sein, nur wenige werden an das „fünfte Buch“ Mose denken, in dem Gott das auserwählte Volk zur Einhaltung der Gesetze ermahnt. Und nur ganz wenigen wird das „Fünfte Buch“ (2012), die „Weltzeitung“, von Alexander Kluge einfallen, mit dem der Filmemacher und Schriftsteller – seinerseits mit leisem Verweis auf Moses – vorführt, wie sich aus kleinen Nachrichten aus dem Ressort Vermischtes, Lebensläufe, Zeitläufte, Weltgeschehen nach-denken läßt.
Dabei wird von der Lokalzeitung keine druckreife Literatur verlangt – allenfalls begrüßt, wo sie auftaucht. Ob man allerdings den Anforderungen einer in Sonntagsreden nach wie vor als unverzichtbar angesehenen Lokalberichterstattung auch nur hinlänglich gerecht wird, indem man eine Plattform für Pressemitteilungen zur Verfügung stellt, darf bezweifelt werden. Der eitle Verweis auf Alexander Kluge sollte ja nur andeuten, daß es für verantwortungsvollen Lokaljournalismus eigentlich keine prinzipiell banalen, unwichtigen Nachrichten geben kann, und daß ohne den unmittelbaren Kontakt der Redaktion zum lokalen Geschehen auf jeden Fall genau das auf der Strecke bleibt, was sich neuerdings die gesamte Journalistengilde wieder auf die Fahnen schreibt, die sie anläßlich der Begräbnisse ihrer Überväter, wie etwa Wolf Schneider oder Alfred Neven DuMont, in den Wind halten. (Vom Qualitätsjournalismus wird noch zu sprechen sein!)
Einige Mißverständnisse
Ist es also sinnvoll, etwaige oder tatsächliche Veränderungen in Sachen Lokaljournalismus einfach im operativen Geschäft einzuholen, indem man als geifernder Trittbrettfahrer bzw. „data miner“, im Internet, in Sozialen Medien, in Blogs mitmischt, sich gierig einkauft und lediglich – um mit Michael Reinhard zu sprechen – durch Schulung von schreibenden Seriöslingen und „Bearbeitung am Desk“ („sofern die Zeit ausreichend dazu da ist“) auf „qualitative Mindeststandards“ achtet? (Das meint die Orthographie freilich längst nicht mehr.) Vor allem: Ist es ausreichend? Hat nicht in dem Maße, in dem Medien über den von ihnen geschaffenen „Erscheinungsraum“ (Roger Silverstone) beinahe allein bestimmend für unser Leben werden, Journalismus überhaupt – also auch der vor Ort bastardisierte, geleistete – mehr gesellschaftspolitische Verantwortung (zu übernehmen) als jemals zuvor? Wo Kultur wie Moral inzwischen fast ausschließlich über Medien konstituiert oder gar ge-posted werden, hängen nun einmal Demokratie, Rechtsstaat, aber selbst alle Menschlichkeit und unser aller Glück tatsächlich in einem sehr engen Sinn davon ab, wie und womit Medien überhaupt gestaltet, gefüttert oder verschmutzt werden, und damit vom Berufsethos jedes einzelnen Journalisten, sei er herkömmlicher, sei er Journalist 2.0 oder Journalist 4.0.
Mehr denn je bedürften wir des Korrektivs Journalismus. Das wird uns gegenwärtig nicht nur in den schon erwähnten Vermächtnissen mitgeteilt – die haben freilich leicht reden. Aber stellvertretend für die weniger wortmächtigen lokalen Aufklärungsbesorger reden uns auch die Größen des Gewerks ins Gewissen. Etwa Cordt Schnibben mit einer mehrseitigen, streckenweise schon peinlichen Homestory (Spiegel Nr. 10 vom 28.2.2015), Jakob Augstein in einer flotten Randbemerkung zur SZ-Serie über die Zukunft des Journalismus (auf die Anzeigenkampagne dieses journalistischen Leuchtturms ist er nicht eingegangen), schließlich sogar der neue Spiegel-online-Chef Florian Harms in einem Letter an die Freunde. „Guter Journalismus macht keine Kompromisse.“ Sagt’s und zeigt wie sorgfältig (beim Spiegel) redigiert wird. Der Leser erkennt leicht, daß zwischen den Qualitätsanforderungen und der Absicherung vor juristischen Auseinandersetzungen praktisch kein Unterschied besteht.
Fragen, Themen, die jeden Journalisten (und Verleger) umtreiben könnten, gibt es also genug. Umso verwunderlicher ist es, daß der Moderator des ersten BJV-Forums seine Stargäste mit kaum einer Frage in eine solche Richtung zu führen suchte. Stattdessen sollte wohl interessieren, warum die Main Post erst jetzt eine sehr restriktive Paywall für ihre wertvollen, „nicht leicht substituierbaren“ (Reinhard), regionalen Inhalte im Internet eingerichtet hat. Interessiert uns das? Höchstens doch insofern, als an den Antworten der beiden Capos deutlich wurde, wie sehr man auch diesbezüglich noch im Nebel stochert. Laut Martin Schwarzkopf etwa hatten die Mainecho-Verleger von vorneherein auf eine strikte Bezahlschranke gesetzt, denn „es kommt auf bezahlte Reichweite an und nicht auf irgendeine Reichweite“. Nur braucht man Reichweite für Werbeumsätze und auch, „um Menschen für uns zu interessieren, die wir über den klassischen Weg nicht mehr bekommen“. Weshalb man beim Mainecho einen Teil der Inhalte wieder kostenlos zur Verfügung stellt – Schwarzkopf: „ganz ohne Reichweite geht es natürlich auch nicht“. Was für ein verbaler Eiertanz.
Allerdings verdeutlichte solcher Einstieg ins Thema des Abends ein wohl auch beim BJV weit verbreitetes Mißverständnis. Aus der Sorge um die eigene berufliche Existenz, die nun einmal am wirtschaftlichen Erfolg des Verlages hängt, wird mehr oder minder stillschweigend eine uns seit Jahrzehnten gepredigte, mittlerweile schon verinnerlichte, aber eben verdrehte Abhängigkeit akzeptiert: Während die Verlage von ihren Mitarbeitern ein Produkt einfordern, daß sich erfolgreich verkaufen läßt, weil es die Leser wollten, wäre stattdessen vom Verlag zu fordern, ein von den Mitarbeitern sorgfältig erstelltes Produkt zu verkaufen, das die Leser brauchen.
Die Orientierung auf das Gemeinwohl ist keine psychische Störung
So sozialromantisch, ja vielleicht weltfremd das klingt, der Unterschied besteht in der Haltung. Wir werden hier keinem Unternehmer verargen, Geld verdienen zu wollen. Seine Produkte, z.B. Autos sollten aber fahren, die Brötchen aus Mehl und nicht Kalk gebacken werden. Als Verleger hat er hingegen zu allererst eine in unserer Verfassung geforderte, gesellschaftspolitische Verantwortung und politische Kontrolle zu übernehmen. Dazu dient die Pressefreiheit, nicht vorrangig zum Gelddrucken! Von dieser Verantwortung haben sich die bundesdeutschen Verlage aber beinahe ausschließlich seit langem verabschiedet. Und wer heute noch solche Verantwortung einfordert wird als Träumer, als Phantast belächelt. Nur ist dies nach wie vor der gedankliche Hintergrund, wo wieder (!) verstärkt von Qualitätsjournalismus die Rede ist. Wo es darum geht, den Bürgern einer demokratischen Gesellschaft für die Meinungsbildung notwendige Informationen (und genaugenommen sogar Bildungsinhalte) anzubieten, die sie zur Bewältigung ihres öffentlichen, beruflichen und privaten, ihres politisch-sozialen Lebens benötigen (wozu bräuchte man ihn sonst?), steht eben dieser Qualitätsjournalismus quer zu einer neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, die Gemeinwohl und selbst überhaupt moralische Werte für psychische Störungen hält.
Insofern offenbaren die Phrasen vom Qualitätsjournalismus (Oft ist es nicht mehr!) gleich noch ein weiteres Mißverständnis. Wo dieser Qualitätsjournalismus, womöglich sogar vom Leser gefordert wird, kann es ja nicht grundsätzlich darum gehen, gelernten Redakteuren (und freien Journalisten) pauschal die berufliche Kompetenz abzusprechen. Nicht jeder Journalist kann (und muß) ein Egon Erwin Kisch, Anton Kuh, Heribert Prantl oder gar Pulitzer-Preisträger sein, nicht jeder Artikel muß ein sprachliches Kunstwerk sein, das beispielsweise der Schauspieler Ulrich Matthes (Spiegel Nr. 50 vom 8.12.2014) auf keinen Fall missen möchte. Tatsächlich wird zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages solides, gutes Handwerk zumeist ausreichen, vor allem dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, Qualitätsjournalismus seitens der Verlage also überhaupt intendiert wäre. Lauscht man Michael Reinhard allerdings, dann sind trotz existenzbedrohender Entwicklungen auf dem Medienmarkt wohl auch bei der Main Post nur journalistische Mindeststandards intendiert. Zwar bezweifelt er beispielsweise eine grundsätzliche Qualitätsminderung durch die schon erwähnte „Verdichtung am Arbeitsplatz“, will aber mit „sozialverträglichen Strukturen“ (Reinhard: „Wir können uns keine Parallelstrukturen erlauben.“) gegenhalten, die eben nicht dazu führen, daß die Mitarbeiter „so ausgelaugt“ werden, daß sie „nicht mehr in der Lage sind die Mindeststandards und letztendlich Qualität zu leisten“, selbst wenn sie unterschiedliche Kanäle bedienen müssen. Das Patentrezept heiß jetzt „Projektjournalismus“. Es wird „nicht mehr produktorientiert produziert, sondern im Prozeß. Was immer das heißen mag. Vermutlich wird Content am Desk oder in mehreren Redaktionen verquirlt, entsprechend der Tagesform einzelner Redakteure gewürzt und in verschiedenen Produkten ausgebacken. Bisweilen mag so etwas Herausragendes entstehen. Allerdings – horribile dictu: „Und nicht mehr die Zeitung ist letztendlich der Thementreiber, sondern die sozialen Medien und online“ (Reinhard).
Die Musik spielt weiter.
Der Chefredakteur der Herzen (des Abends), Martin Schwarzkopf, hingegen setzt ganz traditionell auf Qualität, auf „journalistische Kompetenz, Recherchieren, Sortieren, Einordnen, Bewerten, und dann auch noch einen schönen Beitrag draus machen, den man sich gerne anschaut, gerne anhört, gerne liest …“. Dafür verzichtet er schon auch einmal auf ein Video, wenn es die Verdichtung nicht ermöglicht (wobei man hier einfügen kann, daß für den offensichtlich sehr jungen Moderator der „klassische Zeitungsreporter schon immer mit Block und Kamera unterwegs war“ – jetzt müßte er halt noch filmen); schließlich aber fährt Schwarzkopf wie sein Pendant auf die sozialen Medien ab. „Social media ist bei uns in der Mainecho-Redaktion ein ganz großes Thema“, als Recherchequelle natürlich, um „Menschen und Inhalte zu erreichen, die man anders nicht erreichen kann“. (Sollte man dann nicht konsequent Lokaljournalismus überhaupt im Netz abwickeln?) Objektivierbar sind freilich auch bei ihm – trotz Lippenbekenntnis – allein die Mindeststandards. Es geht schließlich nicht um kalt oder warm, um redundanten Doppelpunktjournalismus, mehr oder weniger Substantivierungen, gefühlstriefende Adjektive oder nicht, sondern um allgemeine Strukturen. Qualitätsjournalismus, das hätten die BJV-Vertreter deutlich machen müssen, meint ein übergeordnetes Konstrukt, um nicht „gesamtgesellschaftlich“ zu sagen, zu dem verlegerisches Herzblut (Augstein, Nannen, Springer, Bissinger) ebenso gehört wie die vielbeschworene Pressevielfalt. Weder berühmte Leseranwälte noch Edelfedern vermögen wettzumachen, was Konzentrationprozesse in der Medienlandschaft und schon eine expansive Verlagspolitik einem „Qualitätsjournalismus“ an Schaden zufügen. Etwa durch Akquisition in geschäftlichen Niederungen, die man früher keines Blickes würdigte, was vor allem Kleinststrukturen zerstört, die in der Mediapolis eigentlich wichtig wären.
Daß die Vielfalt, der Pluralismus auf der Strecke bleibt, räumen natürlich auch die Anchormen der großen Tageszeitungen ein. Nur als brave Diener ihrer Herren spielen sie die Bedeutung der Vielfalt herunter: „Vielfalt ist … gegeben, wenn eine Zeitung eben auf dem Markt bleiben will, die vielleicht sonst verschwunden wäre. Das ist mit Vielfalt allenfalls gemeint.“ So Reinhard, dem freilich auch nicht entgangen sein kann, daß die Pressevielfalt eine unabdingbare Voraussetzung einer demokratischen Gesellschaft ist, sein muß. Sowohl Michael Reinhard wie Martin Schwarzkopf scheinen jedoch mit dem demokratischen Wert Vielfalt eine sehr obskure Vorstellung zu verbinden. Deutlich wird diese beispielsweise, wenn Schwarzkopf auf den Vorhalt einer Abnahme von Vielfalt fast schon empört entgegenhält, daß es am Untermain eine Reihe neuer Mitbewerber gibt – „ob die immer Journalismus machen, darüber kann man sich streiten“. „Aber wir haben mehr Informationsanbieter als jemals zuvor.“ Im Klartext soll das wohl heißen: Die unabdingbare Vielfalt ist gewahrt; auf die journalistische Qualität kommt es im Grundsatz dabei gar nicht an. Hauptsache schön bunt!
Offensichtlich sind die Alphajournalisten überzeugt, daß sich durch die berühmte „unsichtbare Hand“ für den mündigen Bürger aus der Informationsflut automatisch herausschält, was er im oben bereits beschriebenen Sinne zur Lebensbewältigung benötigt. Den einzelnen Verlag bzw. Verleger kann man mit Recht also gar nicht auf Punkt und Komma der Verfassung verweisen, da das einzelne Produkt den Verfassungsauftrag entweder sowieso nicht alleine erfüllen kann oder gerade dann erfüllt, wenn es ihn nicht erfüllt. Womit man mit dem nicht minder berühmten Mandeville-Paradox behauptet, je mieser die journalistischen Angebote, je versauter die Inhalte, desto besser ist es für die Gesamtheit des Gemeinwesens.
Anders müßten sie, die genannten Chefredakteure, nämlich einräumen, daß Pluralismus, sohin auch die Medien-Vielfalt keine bloße Formalie sein darf. Unsere Wirklichkeit, unsere Humanität entsteht in kommunikativen Akten durch das gegenseitige Anerkennen von Differenzen und Gemeinsamkeiten. Wo mediale Vielfalt sei es durch politischen Totalitarismus oder wirtschaftliche Konzentrationsprozesse verhindert bzw. ausgemerzt wird, kommt es zu gesellschaftlicher Erstarrung. Deshalb kommt es auf die Qualität der Kommunikationsbeiträge an, allein deshalb ist journalistische Qualität überhaupt wichtig. Gelegentlich ein gut geschriebener Artikel in der regionalen Monopolpresse wird den gesellschaftspolitischen Anforderungen an die vierte Macht allerdings nicht gerecht. Das ist dann wie beim Untergang der Titanic: Die Musik spielt einfach weiter.