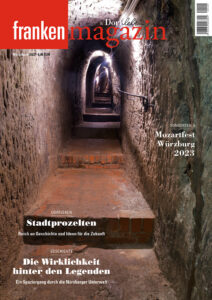Wo das Christsein auf den Punkt gebracht wird
Modernen Menschen scheint das Leben in einem Orden heute ein bißchen aus der Zeit gefallen. Die Aussichten für das Fortbestehen traditionellen Klosterlebens sind auch düster. Aber was passiert, wenn die soziale Arbeit von Ordensleuten komplett wegfällt?
Text: Ursula Lux | Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Drei Kindergärten, ein Hort, eine Jugend- und Familienbegegnungsstätte, zwei Krankenhäuser, ein Alten- und ein Pflegeheim, zwei Stuben zur Bedürftigenspeisung und Hilfen für Geflüchtete – die Kongregation der Schwestern des Erlösers engagiert sich in Unterfranken auf vielfältige Weise. Der 1849 von Alfons Maria Eppinger gegründete Orden zur „Verpflegung armer Kranker und zur Unterstützung anderer Armer“ ist aus der Region Würzburg/Schweinfurt nicht mehr wegzudenken. Zusätzlich ist der Orden auch noch in Nordamerika und Tansania aktiv. Eine beachtliche Bilanz, vor allem angesichts der Tatsache, daß die Kongregation das Schicksal fast aller deutschen Ordensgemeinschaften teilt: Die meisten Mitglieder sind hochbetagt, und der Nachwuchs fehlt. Aktuell gehören noch 172 deutsche Schwestern zur Gemeinschaft, deren Durchschnittsalter liegt bei stolzen 83 Jahren. Hat das Klosterleben überhaupt noch Zukunft? Und wenn nicht, was wird dann aus den Einrichtungen und dem Engagement der Schwestern? Für die erst im August 2019 wiedergewählte Generaloberin Monika Edinger ist dies keine Frage. „Viele Ordensgemeinschaften stellen sich darauf ein, daß es zu Ende geht“, weiß sie, ihr Fokus aber ist ganz und gar nicht auf ein mögliches Ende, sondern auf Zukunft hin ausgerichtet. Dabei ist sie einerseits durchaus realistisch: „So, wie Ordensleben im Moment ist, kommen keine jungen Leute mehr.“ Andererseits aber strahlt sie eine geradezu ansteckende Zuversicht aus. „Gott hat für uns eine Zukunft.“ Man brauche das Vertrauen, daß Gott einem Wege zeige, und dann die Bereitschaft, diese auch zu gehen, erklärt sie.
Werte und Spiritualität sind zeitlos
Die ersten Schritte in Richtung Zukunft hat die Gemeinschaft schon getan, berichtet Schwester Monika. „Wir versuchen verstärkt, unsere Mitarbeitenden für unsere Werte zu gewinnen“, erklärt die Generaloberin. Es gelte, den Geist der Kongregation zu erhalten, auch wenn die Schwestern einmal nicht mehr da sein sollten. Allein in Deutschland hat die Gemeinschaft rund tausend Mitarbeitende. Und die sind beileibe nicht alle katholisch, sie spiegeln das gesamte Spektrum der Gesellschaft wider; vertreten sind Christen ebenso wie Mitglieder anderer Religionen, Konfessionslose, Kirchennahe und Kirchenferne. Wichtig ist den Schwestern nur, daß die Mitarbeitenden die christliche Grundeinstellung mit ihnen teilen. Die Grundlage des gemeinsamen Arbeitens und Miteinanders haben die Ordensschwestern in elf Worte zusammengefaßt: Barmherzigkeit, DaSein, DeMut, Glaube, Hingabe, Lebensfreude, Verantwortung, Vertrauen, Versöhnung, Erlösung, Würde. Um diese bei den Mitarbeitenden zu verankern, tut die Gemeinschaft einiges. Die Mitarbeitenden sind bei den kirchlichen Festen ebenso dabei wie bei Rad- oder Wandertouren, bei denen die Spiritualität der Gemeinschaft immer eine Rolle spielt.
Alle sind eingeladen, die Spiritualität der Schwestern zu teilen und sich allgemein mit der Frage auseinanderzusetzen, was eigentlich ein christliches Verständnis von Gott und der Welt ist. „Unsere Mitarbeitenden sind die Multiplikatoren, die unsere Werte in die Welt tragen“, erklärt Schwester Monika. Seit sie so eng mit einbezogen werden, setze sich auch die Gemeinschaft selbst wieder intensiver mit ihren Werten auseinander, stellt sie fest. Die Erlöserschwestern wollen den Fokus auf das legen, was erhaltenswert ist. Und das sind nicht unbedingt nur die Klosterschwestern, die in einer Gemeinschaft zusammenleben, sondern vielmehr die Werte, die diese repräsentieren und umsetzen.
Aber nicht nur Werte werden geteilt, sondern auch Verantwortung. Die Geschäftsleitung beispielsweise war auch beim Generalkapitel der Kongregation dabei und hat mit beraten. „Das birgt eine ganz andere Dynamik und eine Chance, wir lernen voneinander“, erklärt die Generaloberin. Auch nach außen öffnet sich die Gemeinschaft. „Das Ordensleben wird sich verändern“, da ist sich Schwester Monika sicher. Es brauche neue Formen der Zugehörigkeit, mit unterschiedlicher Intensität und Verbindlichkeit. So wird das Klosterleben auf Zeit wieder neu aufgestellt. Und es gibt die Gruppe der sogenannten „Assoziierten“. „Ein sperriges Wort“, bemängelt Schwester Monika, „aber es ist uns noch kein besseres eingefallen.“ Zwei Jahre lang treffen sich Menschen sieben Mal für zwei Tage, um sich mit Fragen des Christseins auseinanderzusetzen. Danach entscheiden sie sich, ob sie dieser Gruppe zunächst für ein Jahr angehören wollen. In engem Austausch miteinander und mit den Schwestern leben sie dann ihr Christsein im Alltag und sind Mitglieder der Assoziiertengemeinschaft.
Die ganz konkreten weltlichen Herausforderungen

Neben dem Blick auf eine neue Form spirituellen Miteinanders hat die Kongregation aber auch sehr gegenwärtige weltliche Herausforderungen zu meistern. So sind die beiden Krankenhäuser in Schweinfurt und Würzburg durch das derzeitige Gesundheitssystem unterfinanziert. Zwar werden die laufenden Betriebskosten durch die Krankenkassen getragen und für notwendige Neu- und Erhaltungsinvestitionen gibt es Fördergelder des Freistaats, aber für ein freigemeinnütziges Haus gibt es keinen Defizitausgleich durch eine Kommune.
Für den Orden bedeutet dies einen permanenten Spagat. Betriebswirtschaftlich gesehen müßten die Krankenhäuser eigentlich wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen agieren, sie dürfen aber keine größeren Gewinne erzielen, da sie ja gemeinnützig sind. Die betriebswirtschaftliche Sichtweise aber steht dem Anspruch der Gemeinschaft an ein gutes Krankenhaus entgegen. So soll nicht in allen Bereichen der Rotstift so lange angesetzt werden, bis nicht mehr viel übrigbleibt an Zeit und Zuwendung für die Patienten. Die Kongregation sieht ihre Mitarbeitenden eben nicht in erster Linie als Kostenfaktor, sondern als ihr Erfolgsmodell.
Die Personalnot macht allerdings auch vor den Toren der kirchlichen Krankenhäuser nicht halt. Dennoch gelingt es den einzigen konfessionellen Krankenhäusern in der Region, immer noch gute Pflegekräfte zu finden. Das liegt unter anderem an der guten Arbeit und Vernetzung des Pflegedirektors Stefan Werner, wie auch an der etwas anderen Atmosphäre, die auf den Stationen herrscht. Dazu kommt, daß die Kongregation eine eigene Krankenpflegeschule betreibt und so alljährlich selbst für den eigenen Bedarf ausbildet. Die Schwestern können aus Altersgründen nicht mehr in der Pflege arbeiten, dennoch springen viele von ihnen immer noch ein, helfen mit, haben ein offenes Ohr für die Patienten und bereichern so auch die Teams auf den Stationen.
Der Blick über den Tellerrand
Im ärztlichen Bereich dagegen ist es sehr viel schwieriger, gutes Personal zu finden. Dabei spielt die Außensicht auf die kleineren Häuser eine große Rolle. Viele junge Ärzte und Ärztinnen meinen, daß an einer kleineren Klinik keine interessanten Aufgaben auf sie warten. „Das Gegenteil ist der Fall“, erklärt Yvonne Riegel-Then, Personalleiterin im Krankenhaus St. Josef Schweinfurt und der Theresienklinik Würzburg, „bei uns findet Hochleistungsmedizin statt und dies in einem interdisziplinären Umfeld, in dem der Blick über den Tellerrand des eigenen Fachbereichs das Salz in der Suppe ist. Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen bei komplexen Fällen ist genau das, was andere Häuser häufig nicht mehr anbieten können, da sie einfach zu groß und weit verstreut sind.“ Es mache gerade den Reiz eines kleineren Hauses aus, daß alles unter einem Dach sei, bekräftigt Riegel-Then.
Über den Tellerrand blickt die Gemeinschaft nicht nur im Krankenhaus, sie hat sich selbst international aufgestellt. So gingen bereits 1924 die ersten Schwestern in die USA. Heute leben in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania 15 „Sisters of the Redeemer“. Sie initiierten ein großes Gesundheitsnetzwerk, das heute mehr als 4 000 Mitarbeitende umfaßt. Die Schwestern dort arbeiten im Gesundheitssy-stem, bieten Seminare an und betreiben einen Gemeinschaftsgarten.
Seit 1957 leben und arbeiten Schwestern des Erlösers auch in Tansania. An acht unterschiedlichen Standorten kümmern sie sich um Kinder und Kranke. Gesundheitszentren, Kindergärten und Schulen entstanden. Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen werden in der Montessouri-Pädagogik ausgebildet und hier gibt es auch junge Frauen, die sich für das -Ordensleben berufen fühlen. Sie nehmen am Gemeinschaftsleben der Schwestern teil, werden in das Charisma und in die Spiritualität der Kongregation eingeführt und bekommen eine schulische Ausbildung. Für ihre Arbeit in Afrika sind die Schwestern allerdings auch auf Spenden angewiesen. Rund 60 bis 70 Prozent der Kosten erwirtschaften die tansanischen Ordensschwestern selbst. Der Rest wird aus Spenden gedeckt. Firmen engagieren sich hier ebenso wie Einzelspender, viele von ihnen haben einen persönlichen Bezug zu den Schwestern. Das Geld kommt zum Teil aus Stiftungen und natürlich unterstützt auch das Mutterhaus die Gemeinschaft in Tansania. Dies geschieht vor allem projektbezogen. So brauchte man vor kurzem beispielsweise einen neuen Schulbus; das Mutterhaus in Würzburg übernahm einen Teil der Kosten, damit der Bus schnell angeschafft und die Kinder die Schule weiterhin erreichen konnten.