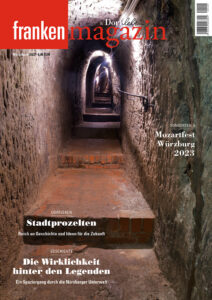Der Tod mag Wurst (gegrillt)
Eine kleine Phänomenologie der Imbißbude – zwischen fun-food und Brunftarena. (Nichts für empfindsame Feinschmecker.)
Text + Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach
Natürlich wäre ich lieber Aufklärungsbesorger, Kinogänger oder Fünfsterneschwan auf dem Chiemsee statt Fernfahrer mit gewissen Fotokenntnissen und halbherziger Selbstkritiker. In puncto Geselligkeit nähme sich das fast nichts: Man säße vielleicht nicht so oft vereinsamt an einer Ökotopengrenze – also der Grenze beispielsweise zwischen Getreidefeldern und richtig fränkischem Wald – neben plattgewalztem Erdpech, aus dem sich an schludrigen Stellen das Schottergras quetscht, annähernd wie am Ufer des sagenhaften, antiken Flusses Sambatyon, der nur aus Felsgeröll und Sand besteht und den man allerhöchstens am Sabbat überqueren könnte, will man nicht von einem Vierzigtonner überrollt werden. Andererseits entbehrte man beim Italiener um die Ecke der Attraktionen der Straße. Ich denke da an mythologische Wesen, wie sie selbst die Schedel’sche Weltchronik nicht zu überbieten vermöchte: Oben Frau mit ansehnlich Busenfett in einer Brünne aus Nappaleder, unten das Gesäß einer Reichsunmittelbaren auf einem Roller mit 50 ccm- Zweitakt-Einspritz-Motor. Spätestens seit Henry Miller steigern Obszönitäten das Realitätsgefühl.

Aber bleiben wir sachlich: Imbißbuden dienen nach landläufigem Verständnis der ganz irdischen Atzung (Ernährung) und zwar möglichst ohne time-lag. Ein Budenbetreiber, der die Currywurst frisch zubereitet, hat seine Bestimmung verfehlt. Sie muß tagelang auf dem Rost liegen, muß triefen vor Fett in völlig ausgetrockneter Rinde und darf nur noch mit viel Ketchup und Curry-Granulat als Lebensmaterial durchgehen. Ähnlich: Das Döner oder der. Meist steht es in der Ecke wie ein offenes Bein, von dem die Grindel gekratzt werden. Richtig ißt man sie ohne Kraut, Tomaten und solchem Zeug. Nur mit Zwiebel und scharf. Für die Bestellung nutzt man die Gebärdensprache, die – so will es die Legende – vor Unzeiten, als die nahe Autobahn noch eine einzige Schande war, an der B 22 bei Dettelbach erfunden wurde. Deshalb ist die Karte in Ahmets in warmen Regenbogenfarben (zumindest außen) gehaltenem Verschlag, sehr übersichtlich und klar strukturiert. Es bedarf allein eines energischen Deutens, einer „deiktischen“ Handlung, weil das Ordern von „geschmortem Rehschäufele mit geschwenkten Waldpilzen und fränkischem Kloß“ selbst einen vielarmigen Vishnu vor ernste Probleme stellte. Deutungsmäßig!
Niedergang der europäischen Eßkultur

Genaugenommen ist der Imbiß an der Straße jedoch ein Teilselbstmord; der Talkshowphilosoph Peter Sloterdijk würde einen „Todesappetit“ ausmachen. Symbolisch, natürlich! Coal rollers, also Schwachköpfe, die ihre Pick-up-trucks so umgebaut haben, daß sie möglichst viel Rußwolken zum Auspuff hinausjagen – ein neues Hobby in den USA, das belegt, daß Autofahren auch den Geist verschmutzt – wird es bei uns vorerst zwar nicht mehr geben, aber Zweifel, daß die Kohlendioxid- Emissionen selbst eines zivilisierten Verkehrs direkt unseren Wäldern, unserer Gesundheit, unserem Leben schaden, bestehen kaum. Was mir einmal mehr meinen antiken Lieblingskönig, Erysichthon von Th essalien, in Erinnerung ruft. Besagter König hatte eine von Demeters (griechische Muttergöttin) heiligen Eichen gefällt und so die darin lebende „Dryade“, eine Baumnymphe getötet (Sie verstehen: Waldsterben!). Woraufhin die Fruchtbarkeitsgöttin – wir müssen die Geschichte etwas zeitgemäßer ausdrücken – ihn mit einer unstillbaren Freßsucht bestrafte; (Fast food, Adipositas – bis 2030 wird jeder zweite Deutsche fettleibig sein. Etwa 100 Millionen Amerikaner sind es jetzt schon.) Erysichthon mußte fortan alles vertilgen, was ihm vorkam und verzehrte am Ende sich selbst. Wo anders – geraderaus gefragt – als auf dem Parkplatz einer Grilloase, gebratenen, mit Fett und Blut gefüllten Schweinedarm (vulgo: Bratwurst) in Händen, wird einem die eigene autophage, sich selbst verzehrende Zukunft deutlicher vor Augen geführt? Na, schön: Eine etwas bemühte Symbolik, nur wie wollte man sonst dem existentiellen Dilemma von uns Spätmenschen auch nur halbböse gerecht werden? Selbst wenn man es nicht so transzendent nimmt, bleibt festzuhalten, daß der Verzehr von viel Wurst ohnehin die Lebenserwartung stark mindert. Der Tod mag Wurst; die Imbißbude an sich als mächtiger Wurstdistributor ist also keineswegs nur Ausdruck des Niedergangs der europäischen Eßkultur, sondern ein fürwahr sehr vielschichtiges Phänomen. Es gibt sie ja auch überall, europaweit, weltweit. Wir können das nur anreißen (sagt man heute so): Auf dem flachen Land etwa ersetzte sie überall dort, wo die Gemeinde großkotzig ein Gewerbegebiet auswies, die traditionelle Dorfkneipe – zumindest ernährungstechnisch; den Alkoholikerbedarf deckt die Tanke. Sobald allerdings ein Supermarkt (da Bäcker, Metzger und Lebensmittelladen längst das Handtuch geschmissen haben) eröffnet wird, sind wiederum die Tage der Imbißbude gezählt. Da die wenigen Ketten (bis hin zu Baumärkten) den Rachen nicht vollkriegen und in ihren Niederlassungen gern auch ein Café, eine „Heiße Theke“ oder gleich ein freilich höchstens drittklassiges Restaurant eröffnen, nehmen sie den Imbißbuden die Kundschaft weg. Allein in den größeren Städten, in denen die Dichte von Imbißbuden eine Art Elendsindex darstellt, kann sich die Mikrogastronomie noch relativ sorgenfrei halten, weil ihre proletaroide Klientel ohnehin nicht einkaufen geht. Jedenfalls konnte dem aufmerksamen Beobachter in den letzten zehn, zwanzig Jahren nicht entgehen, daß Imbißbuden beispielsweise in den 90er Jahren beinahe zu verschwinden drohten – zumindest im Westen, während sie im Osten wie Pilze aus dem Boden schossen.


Authentizitätsreservate
In den Nullerjahren aber tauchten sie allerorts wieder auf, allerdings diversifiziert. Heute gibt es bei den Imbißbuden deutliche Klassenunterschiede. Es gibt die ontologisch steigerungsfähigen Buden, die sich praktisch von Woche zu Woche mehr Richtung Restaurant bewegen. Es gibt den Imbiß, um den ein ganzes Haus gebaut ist – Läden, in denen früher Uhrmacher oder Tabakhändler ihr mit der Vergänglichkeit verbrüdertes Unwesen trieben und die für Douglas oder irgendeine Beckkette zu klein sind; Döner macht schöner! Im weitesten Sinne gehören sie zu den dezidierten Ethno-Imbissen: Shushi, Tacos, Burger, Leberkäs, um die herum mitunter sogar regelrechte Brunftarenen entstehen. Und es gibt den notdürftig überdachten, geräderten Feldgrill. Ein Nachteil vieler dieser kulinarischen Amüseen ist das Fehlen jeglicher Möglichkeit, Überflüssiges gepflegt zu debardieren, auf Deutsch: Es fehlen meist Toiletten. Vermutlich werden deshalb die traditionellen Imbißbuden bevorzugt von Männern aufgesucht, denen ohnehin ein erbärmlicher Geschmackssinn nachgesagt wird und die speziell das typische Fleischaroma Umami – angeblich nichts als der Geschmack von Glutamat – gar nicht schmecken können. Was dann natürlich Auswirkungen auf das allgemeine Befinden nach der Nahrungsaufnahme haben könnte.
Bleibt zu fragen, ob Imbißbuden neben einem mysterium tremendum (abschreckend) nicht auch über ein mysterium fascinosum (anziehend) verfügen. Das ist der Punkt. Imbißbuden sind tatsächlich in vieler Hinsicht echte Attraktionen. Sie sind originell, entziehen sich der allgemeinen Nivellierung aller Unterschiede, sind kleine Farbkleckse, sind individuell bis stillos gestaltet, manchmal liebevoll geführt, sind oft regelrechte Authentizitätsreservate, fernab aller modernen Fungibilität, Austauschbarkeit, Beliebigkeit, die die Zentren beinahe aller Städte ununterscheidbar macht. Es bleibt gar keine andere Möglichkeit als über Imbißbuden nach allen Regeln der Kunst herzuziehen, um der sogenannten Mainstream-Falle Vorschub zu leisten: Man verrät einen Geheimtip, wo man genießt, seine Ruhe hat … und plötzlich gehen alle da hin! Das mögen die Lichtalben (das sind die Götter der Fotografen) verhüten.