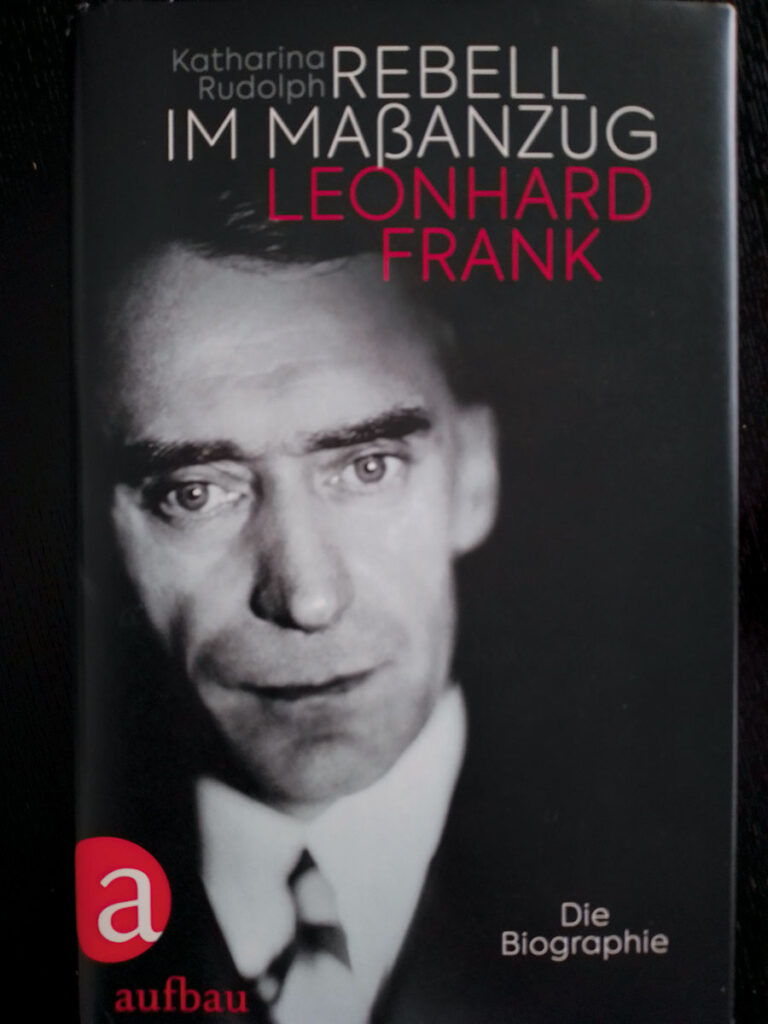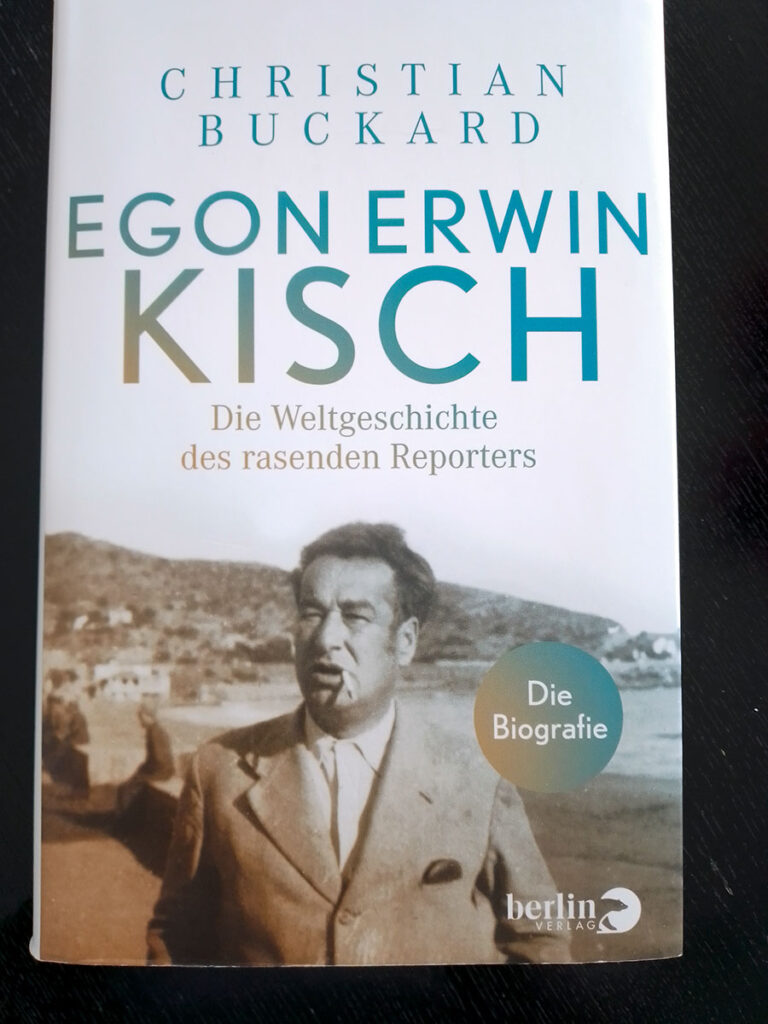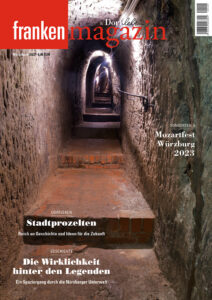Freunde fürs Leben
Einer kam aus Würzburg, der andere aus Prag. Beide waren ziemlich verschieden, trotzdem trafen sie sich in der Weltmetropole Berlin vor 100 Jahren regelmäßig in einem Künstlercafé. Für viele sind Leonhard Frank und Egon Erwin Kisch bis heute Vorbilder. Nicht nur wegen ihrer Bücher.
Text: Klaus Hanisch
Leonhard Frank und Egon Erwin Kisch erreichten mit ihren Büchern und Artikeln in den „Goldenen Zwanzigern“ ein Millionenpublikum. Kaum hatten sie an einem Tisch nebeneinander Platz genommen, begannen dennoch sofort „Kampfgespräche über Literatur.“ Das ging Frank nie aus dem Kopf. Und ebenso, daß diese Diskussionen „jeden Tag bis fünf Uhr früh“ andauerten. „Da wir spätestens bis vier Uhr nachmittags wieder im Café sein mußten und, wie ich mich mit Bestimmtheit erinnere, doch auch irgendwann geschlafen haben, frage ich mich heute vergebens, wann wir eigentlich unsere Bücher schrieben.“ Darüber staunte der Franke noch viele Jahre später. Die Literaten waren fast der gleiche Jahrgang, stammten aber aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Kisch wurde im April 1885 als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Tuchhändlers in Prag geboren, Frank im September 1882 in eine bitterarme protestantische Familie im katholischen Würzburg. Beide zogen schon vor dem Ersten Weltkrieg nach Berlin. Egon Erwin Kisch bereits 1905, um für ein paar Monate an der ersten Journalisten-Hochschule in Deutschland zu lernen. Sein Eindruck von der Stadt war verheerend. „Berlin im allgemeinen ist furchtbar“, schrieb er seinem Bruder Paul, „der Berliner ist im allgemeinen ein Ekel, im besonderen zwei Ekel, die Berlinerin ein ganzes Konglomerat von Ekeln.“
Ganz anders Frank, der vier Jahre nach Kisch in die Metropole kam. Damals hatte Berlin bereits 2,1 Millionen Einwohner und wurde von Künstlern und Intellektuellen gleichsam als El Dorado entdeckt. „Nerv und Geist der Stadt waren elektrisiert, das Leben selbst war elektrisiert“, schwärmte er.
Trotz seiner anfänglichen Abneigung nahm auch Kisch im Sommer 1913 einen zweiten Anlauf. Seine „heimliche Sehnsucht war, daß zumindest einige seiner Texte als Literatur und Kunst anerkannt würden“, erläutert Christian Buckard in einer gerade veröffentlichten Biographie zu dessen 75. Todestag. Er fürchtete, daß seine Artikel und Reportagen nicht viel Wirkung auf die Gesellschaft ausüben würden. Deshalb wollte sich Kisch in Berlin nun vor allem als (Roman-)Schriftsteller etablieren.
Das war Leonhard Frank bereits gelungen. Sein Debütwerk „Die Räuberbande“ über seine Kindheit und Jugend wurde 1914 sofort mit dem Fontane-Preis als „bester deutscher Roman des Jahres“ ausgezeichnet. Ein erstaunlicher Erfolg, denn erst in Berlin entschloß sich Frank, nicht mehr nur als Maler, sondern zudem als Schriftsteller zu arbeiten. Als er Kisch zum ersten Mal begegnete, schlenderte der Böhme mit seinem gerade erschienenen Roman „Der Mädchenhirt“ unterm Arm durch die Tür des Kaffeehauses. Er war „umgeben von seinen Bewunderern und einer erklecklichen Anzahl hübscher junger Mädchen (siehe Romantitel)“, schrieb der Franke genüßlich.
Er selbst wurde im Gegensatz zu dem eitlen und extrovertierten Kisch als unauffällig, zurückhaltend und verschlossen beschrieben. Leonhard Frank spreche stockend, formuliere aber ebenso eigenartig wie präzise, merkten Zeitzeugen an.
Kisch und Frank saßen oft Stuhl an Stuhl im „Café des Westens“ an einer Ecke des Kurfürstendamms. Es ging als „Café Größenwahn“ in die Annalen ein, weil bei manchem Gast Ehrgeiz und Können nicht immer übereinstimmten. Für alle Künstler waren Kaffeehäuser indes nicht nur Orte für die Freizeit, sondern vor allem Horte der Arbeit und des Austausches. Die Cafés boten Zeit und Raum, um andere (und ihre Ansichten) näher kennen, schätzen oder hassen zu lernen.
Es wurde viel getrunken, noch mehr geraucht und eifrig gestritten. Und zuweilen gab es Ohrfeigen. Eine machte Frank berühmt. Im „Café des Westens“ wurde er im Mai 1915 gegen einen Journalisten handgreiflich, weil er die Versenkung des englischen Passagierschiffs „Lusitania“ mit 1 200 Toten durch ein deutsches U-Boot feierte.
Danach ging Frank zum ersten Mal ins Exil. Warum, erschließt sich seiner Biographin Katharina Rudolph nicht. Frank weiche in seiner Darstellung „entscheidend vom wirklichen Geschehen ab“, schreibt sie in einem Buch, das in Vorbereitung auf Franks 140. Geburtstag im letzten Jahr aufgelegt wurde. Die Autorin fand weder Hinweise auf einen Haftbefehl gegen ihn, wie Frank selbst angab, noch auf eine Denunziation.
Die gemeinsame Zeit mit Kisch (und anderen) in Berlin empfand Leonhard Frank „als Idylle“, die der Erste Weltkrieg „wegwischte“. Schon in Berlin begann er mit Aufzeichnungen für sein wichtigstes Werk: „Der Mensch ist gut“ schilderte das Leiden von Menschen im Krieg. Ein Appell gegen Militarismus und Nationalismus und ein Antikriegswerk, das für den Kritiker Marcel Reich-Ranicki ein „europäisches Ereignis“ war.

In den 1920er Jahren trafen sich Frank und Kisch wieder in „Groß-Berlin“, das nun fast vier Millionen Einwohner zählte und damit eine der größten Citys der Welt war – für Leonhard Frank sogar die „Weltstadt der Weltstädte“ schlechthin. Seine Werke verschafften ihm jene finanziellen Mittel, die er angesichts seiner ärmlichen Herkunft immer angestrebt hatte. Sein Ruhm war nun so groß, daß er „in einem Zug mit Thomas Mann und Franz Werfel“ genannt wurde, wie Armin Strohmeyr im Nachwort zu Franks autobiographischen Roman „Links wo das Herz ist“ erinnerte.
Frank pflegte einen neuen Lebensstil, bürgerlich, als Dandy und Genießer. Zugleich geriet sein Weltbild vom Sozialismus ins Wanken. Er bezeichnete sich selbst als einen „kämpfenden deutschen Romanschriftsteller in der geschichtlich stürmischen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“. Doch Konzepte von linken Gruppen, die ihm nahestanden, hatten für ihn keinen Wert. So nannte ihn Ralph Grobmann in seiner Dissertation einen „Gefühlssozialisten im 20. Jahrhundert“. Franks Neuorientierung kam nicht bei allen gut an. Auch KP-Mitglied Kisch stimmte in den Chor ein. Als er Franks Roman „Das Ochsenfurter Männerquartett“ rezensierte, wünschte er, daß sich der „am Klassenkampf geschulte“ Autor wieder zu einem „einfachen Menschentum in revolutionärer Weise“ bekenne.
Trotzdem arbeiteten beide in einer längst vergessenen „Gruppe 1925“ mit, die „Literaturgerichte“ mit Kisch als Verteidiger und Frank als Sachverständigem oder Angeklagtem veranstaltete. Und sie wurden zu einem „Kongreß der Werktätigen“ im Dezember 1926 in Berlin entsandt. Ihr neuer Treffpunkt war das „Romanische Café“ nahe der Gedächtniskirche. An ihrem Stammtisch nahmen neben anderen auch Joseph Roth und der noch unbekannte Filmemacher Billy Wilder Platz.
Kisch hatte nun „Weltgeltung“, man nannte ihn gar „König der Journalisten“, wie sein Berliner Apologet Klaus Haupt ausführte. Auch Buckard unterstreicht, daß er in den 1920er Jahren der „berühmteste Reporter Deutschlands“ war. Dies lag vor allem an seinem Bestseller „Der rasende Reporter“, bis 1933 in 15 Auflagen publiziert. Der Titel erwies sich zudem als äußerst geschickter Marketing-Gag und prägt sein Image bis heute. Doch „den ‚rasenden Reporter‘ hat er sich nur ausgedacht“, stellte Lenka Reinerová gegenüber dem Autor dieser Zeilen während eines langen Gesprächs im Prager Café „Slavia“ wenige Jahre vor ihrem Tod richtig, „die Arbeitsweise von Kisch war alles andere als rasend“. Reinerová war eine enge Freundin von Kisch und galt als letzte Prager Schriftstellerin deutscher Sprache.
Auch sonst nahm es Kisch mit der Wahrheit nicht immer genau. In seinem 1923 herausgegebenen Band „Klassischer Journalismus“ formulierte er als Credo, daß ein Journalist „keine Tendenz, nichts zu rechtfertigen und keinen Standpunkt“ habe, nur „unbefangen Zeuge“ sein soll und berichten müsse so „verläßlich, wie sich eine Aussage geben läßt.“
Für seine eigene Tätigkeit mußte jedoch nicht alles Wort für Wort stimmen, wenn es insgesamt wahrhaftig war. „Ein bißchen Fantasie“ fand er für angemessen, damit seine Texte von möglichst vielen und bis zum letzten Wort gelesen werden, schreibt Buckard. Denn Kisch wollte nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Eine erfundene Pointe hatte für ihn zuweilen mehr Wahrhaftigkeit als die Wahrheit selbst.
Zudem hatte er kein Problem damit, Partei zu ergreifen, etwa für den von der Presse gescholtenen Karl May. Oder für den Kommunismus. Und bezüglich einer Tendenz galt für den selbstbewußten Egon Erwin Kisch: „Mein Standpunkt ist der richtige.“ Während ein Reporter von Tatsachen abhängig sei, zeichnete sich „gute Literatur“ für ihn durch eine interessante Geschichte aus, die sich durch Fakten nicht „unnötig beirren“ lassen müsse, so Buckard.
Auch der Wiener Germanist Marcus Patka urteilte in seiner Biographie, Kisch habe Tatsachen für seine Texte „gesehen, gesichtet und verdichtet – mit den Augen eines Dichters“. Er habe sie „im Sinne der Aufklärung“ verfaßt, oft aber „spannend wie einen Kriminalroman“ geschrieben. Prinzipiell gab Kisch dem Roman in der Literatur keine Zukunft, stattdessen werde sich die literarische Reportage durchsetzen – deren erster Vertreter er selbst war.
Dessen ungeachtet folgten Frank wie Kisch mit ihrer Arbeit einem moralischen Kompaß. Der Mainfranke blieb zeitlebens ein überzeugter Pazifist. Für den Prager war der radikale Kampf gegen Ungerechtigkeit und für sozial Schwache nicht nur eine literarische Aufgabe. Ihre Bücher wurden 1933 in Berlin von den Nazis verbrannt. Beide mußten anschließend reichlich Erfahrungen im Exil sammeln. Leonhard Frank flüchtete 1933 zunächst nach Prag, in die Heimatstadt von Kisch.
Zu seinen Ehren legte der Ost-Berliner Aufbau-Verlag im Jahr 1955 posthum den Sammelband „Kisch-Kalender“ mit Texten von Zeitgenossen auf. Darin vermerkte der Mann aus Mainfranken, der Prager hatte „eine Eigenschaft, die wenige Menschen haben“: Kisch war für Leonhard Frank schlichtweg „ein echter Freund“. Obwohl – oder gerade – weil sie in vielem so verschieden waren.